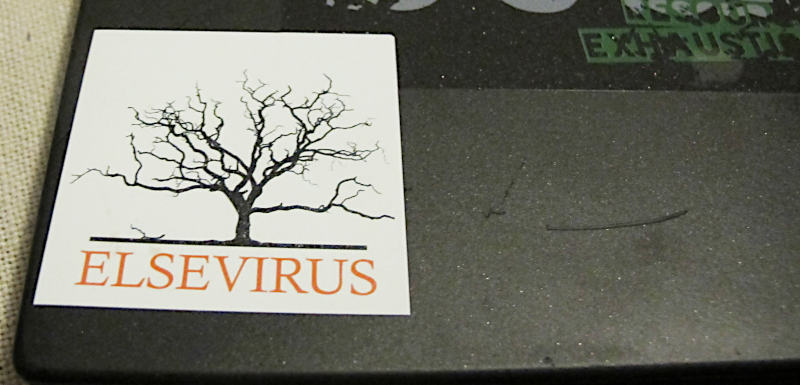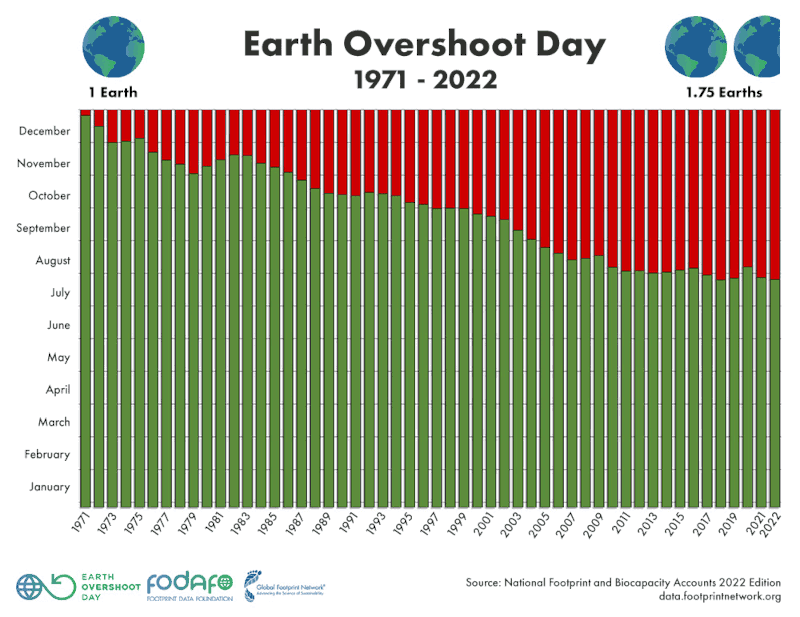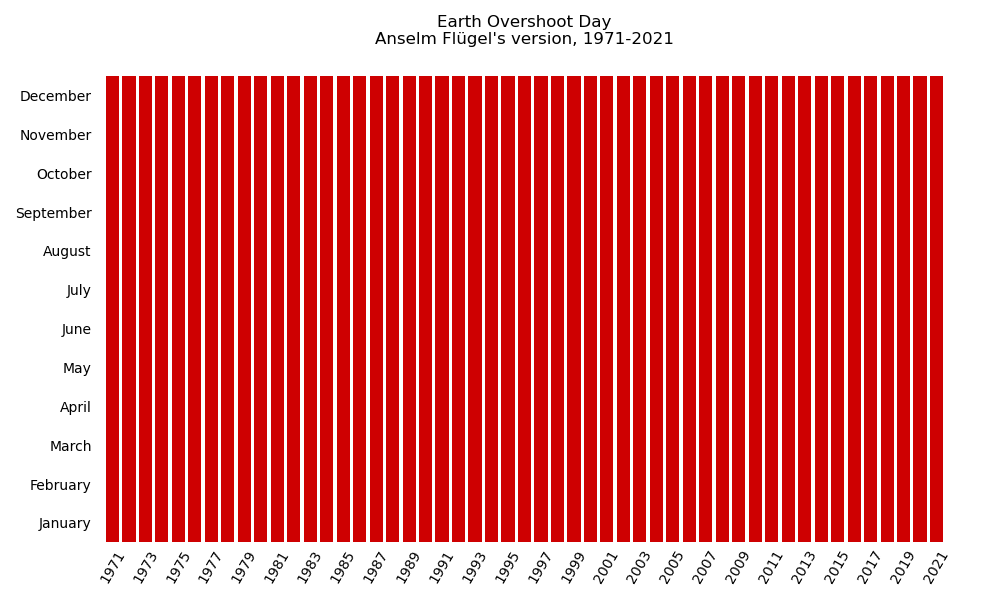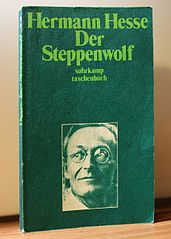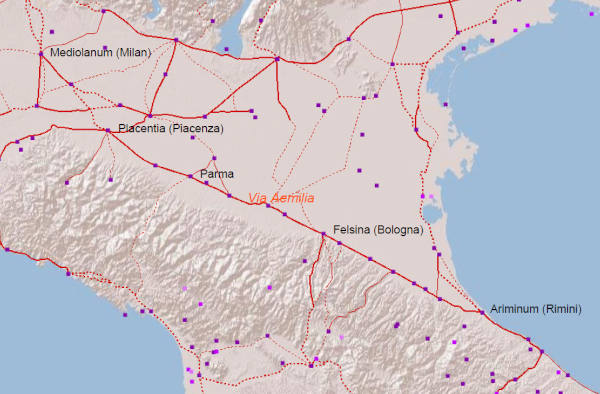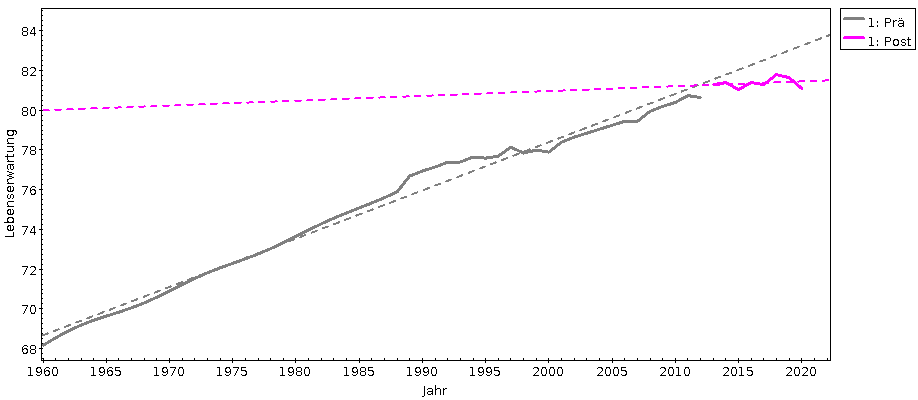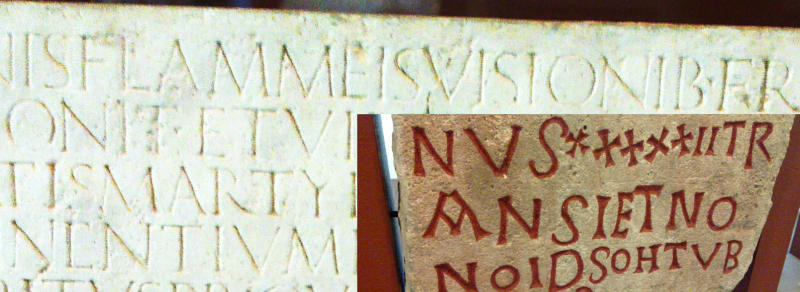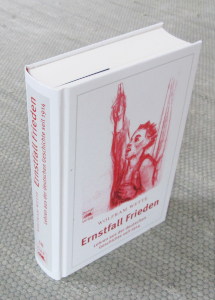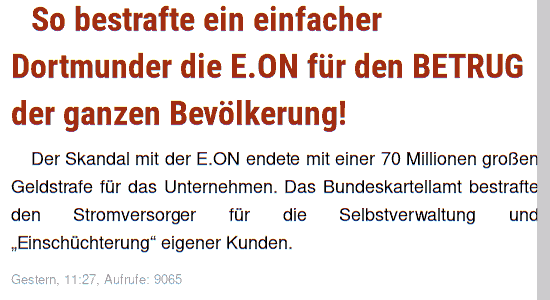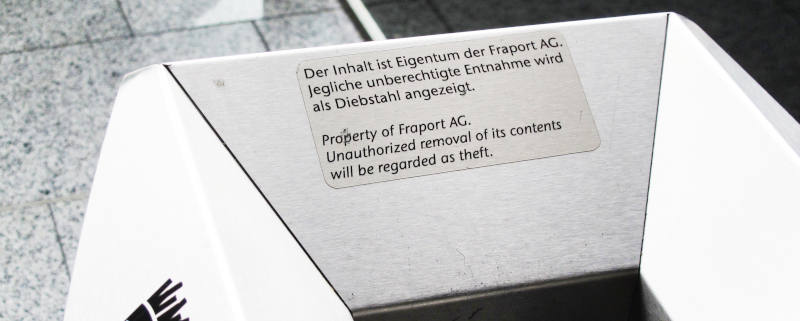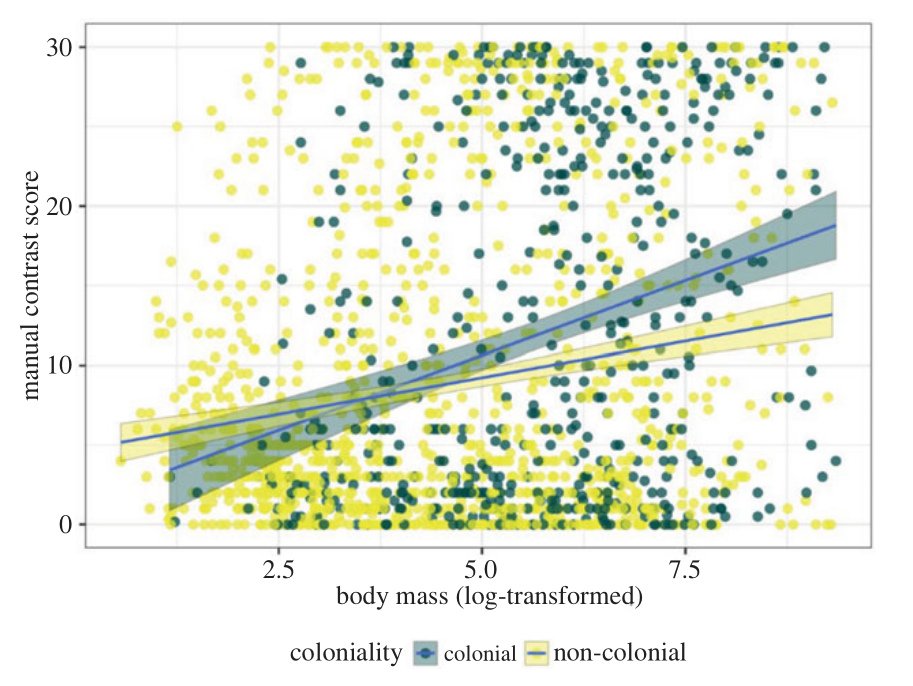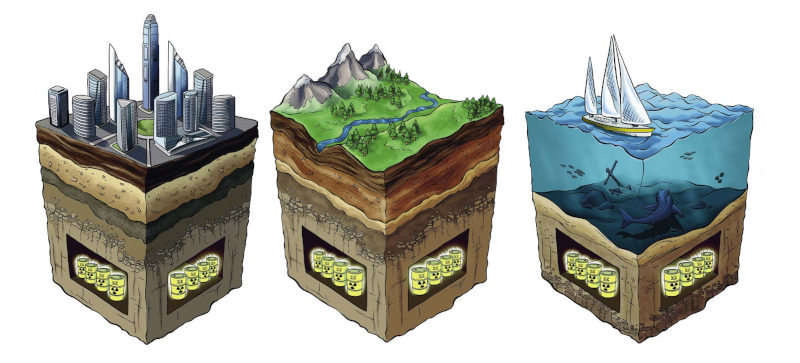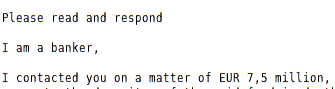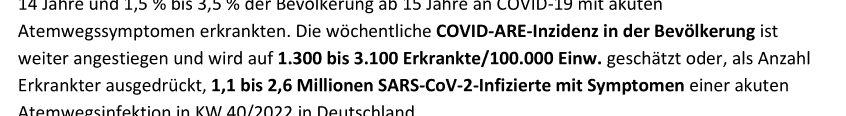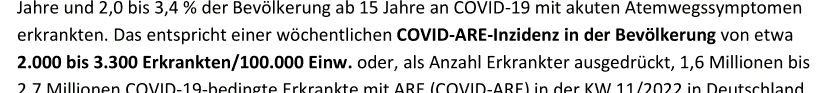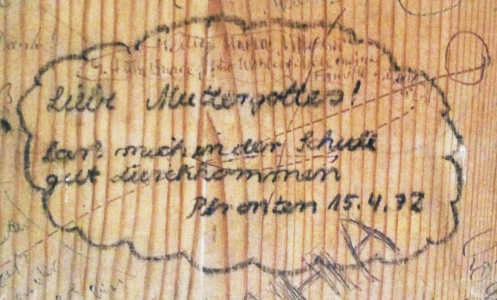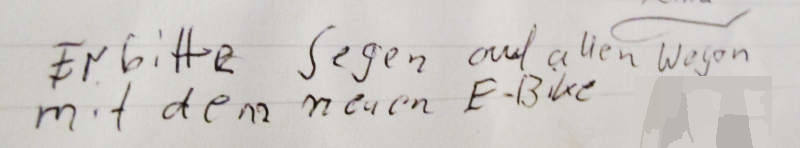Bemerkenswert finde ich das vor allem, weil Hesse in dieser Novelle
schon 1927 einen Autohass entwickelt hat, der in seiner Radikalität noch
heute beeindruckt. Dabei waren 1925 in einem etwas größeren Deutschland
gerade mal 161'000 Autos zugelassen gegenüber heute (bei Pkws)
48'500'000 . Hesse schäumte also bei einer 300-mal kleineren
Autobestandsdichte; da die Autos damals im Schnitt langsamer und
vermutlich auch weniger lang fuhren als heute, dürfte der Faktor bei der
Autoverkehrsdichte noch größer gewesen sein.
Vergleicht angesichts dessen den folgenden Auszug aus dem Steppenwolf
(ich zitiere im Vorgriff auf den 1.1. schon mal großzügig) mit Fritz
Tietz' zeitgenössischem Analogon in der Weihnachts-taz.
Der Ausschnitt setzt ein, als der Titelheld in einer Art (ich
aktualisiere den Kontext ein wenig) wahnsinnigem Virtual Reality-Theater
ist und sich überlegt, was er sich wohl reinziehen soll.
Ich spürte, daß ich jetzt mir selber und dem Theater überlassen sei
und trat neugierig von Tür zu Tür, und an jeder las ich eine
Inschrift, eine Lockung, ein Versprechen.
Die Inschrift
Auf zum fröhlichen Jagen!
Hochjagd auf Automobile
lockte mich an, ich öffnete die schmale Türe und trat ein.
Da riß es mich in eine laute und aufgeregte Welt. Auf den Straßen
jagten Automobile, zum Teil gepanzerte, und machten Jagd auf die
Fußgänger, überfuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der
Häuser zuschanden. Ich begriff sofort: es war der Kampf zwischen
Menschen und Maschinen, lang vorbereitet, lang erwartet, lang
gefürchtet, nun endlich zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und
Zerfetzte herum, überall auch zerschmissene, verbogene, halbverbrannte
Automobile, über dem wüsten Durcheinander kreisten Flugzeuge, und auch
auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit Büchsen und mit
Maschinengewehren geschossen. Wilde, prachtvoll aufreizende Plakate an
allen Wänden forderten in Riesenbuchstaben, die wie Fackeln brannten,
die Nation auf, endlich sich einzusetzen für die Menschen gegen die
Maschinen, endlich die fetten, schöngekleideten, duftenden Reichen,
die mit Hilfe der Maschinen das Fett aus den andern preßten, samt
ihren großen, hustenden, böse knurrenden, teuflisch schnurrenden
Automobilen totzuschlagen, endlich die Fabriken anzuzünden und die
geschändete Erde ein wenig auszuräumen und zu entvölkern, damit wieder
Gras wachsen, wieder aus der verstaubten Zementwelt etwas wie Wald,
Wiese, Heide, Bach und Moor werden könne. Andre Plakate hingegen,
wunderbar gemalt, prachtvoll stilisiert, in zarteren, weniger
kindlichen Farben, außerordentlich klug und geistvoll abgefaßt,
warnten im Gegenteil alle Besitzenden und alle Besonnenen beweglich
vor dem drohenden Chaos der Anarchie, schilderten wahrhaft ergreifend
den Segen der Ordnung, der Arbeit, des Besitzes, der Kultur, des
Rechtes und priesen die Maschinen als höchste und letzte Erfindung der
Menschen, mit deren Hilfe sie zu Göttern werden würden. Nachdenklich
und bewundernd las ich die Plakate, die roten und die grünen,
fabelhaft wirkte auf mich ihre flammende Beredsamkeit, ihre zwingende
Logik, recht hatten sie, und tief überzeugt stand ich bald vor dem
einen, bald vor dem andern, immerhin merklich gestört durch die
ziemlich saftige Schießerei ringsum. Nun, die Hauptsache war klar: es
war Krieg, ein heftiger, rassiger und höchst sympathischer Krieg,
worin es sich nicht um Kaiser, Republik, Landesgrenzen, um Fahnen und
Farben und dergleichen mehr dekorative und theatralische Sachen
handelte, um Lumpereien im Grunde, sondern wo ein jeder, dem die Luft
zu eng wurde und dem das Leben nicht recht mehr mundete, seinem
Verdruß schlagenden Ausdruck verlieh und die allgemeine Zerstörung der
blechernen zivilisierten Welt anzubahnen strebte. Ich sah, wie allen
die Zerstörungs- und Mordlust so hell und aufrichtig aus den Augen
lachte, und in mir selbst blühten diese roten wilden Blumen hoch und
feist und lachten nicht minder. Freudig schloß ich mich dem Kampfe an.
Das Schönste von allem aber war, daß neben mir plötzlich mein
Schulkamerad Gustav auftauchte, der seit Jahrzehnten mir Verschollene,
einst der wildeste, kräftigste und lebensdurstigste von den Freunden
meiner frühen Kindheit. Mir lachte das Herz, als ich seine hellblauen
Augen mir wieder zuzwinkern sah. Er winkte mir, und ich folgte ihm
sofort mit Freuden.
»Herrgott, Gustav«, rief ich glücklich, »daß man dich einmal
wiedersieht! Was ist denn aus dir geworden?«
Ärgerlich lachte er auf, ganz wie in der Knabenzeit.
»Rindvieh, muß denn gleich wieder gefragt und geschwatzt werden?
Professor der Theologie bin ich geworden, so, nun weißt du es, aber
jetzt findet zum Glück keine Theologie mehr statt, Junge, sondern
Krieg. Na komm!«
Von einem kleinen Kraftwagen, der uns eben schnaubend entgegenkam,
schoß er den Führer herunter, sprang flink wie ein Affe auf den Wagen,
brachte ihn zum Stehen und ließ mich aufsteigen, dann fuhren wir
schnell wie der Teufel zwischen Flintenkugeln und gestürzten Wagen
hindurch, davon, zur Stadt und Vorstadt hinaus.
»Stehst du auf seiten der Fabrikanten?« fragte ich meinen Freund.
»Ach was, das ist Geschmacksache, wir werden uns das dann draußen
überlegen. Aber nein, warte mal, ich bin mehr dafür, daß wir die
andere Partei wählen, wenn es auch im Grunde natürlich ganz egal ist.
Ich bin Theolog, und mein Vorfahr Luther hat seinerzeit den Fürsten
und Reichen gegen die Bauern geholfen, das wollen wir jetzt ein
bißchen korrigieren. Schlechter Wagen, hoffentlich hält er’s noch ein
paar Kilometer aus!«
Schnell wie der Wind, das himmlische Kind, knatterten wir davon, in
eine grüne ruhige Landschaft hinein, viele Meilen weit, durch eine
große Ebene und dann langsam steigend in ein gewaltiges Gebirg hinein.
Hier machten wir halt auf einer glatten, gleißenden Straße, die führte
zwischen steiler Felswand und niedriger Schutzmauer in kühnen Kurven
hoch, hoch über einem blauen leuchtenden See dahin.
»Schöne Gegend«, sagte ich.
»Sehr hübsch. Wir können sie Achsenstraße heißen, es sollen hier
diverse Achsen zum Krachen kommen, Harrychen, paß mal auf!«
Eine große Pinie stand am Weg, und oben in der Pinie sahen wir aus
Brettern etwas wie eine Hütte gebaut, einen Auslug und Hochstand. Hell
lachte Gustav mich an, aus den blauen Augen listig zwinkernd, und
eilig stiegen wir beide aus unsrem Wagen und kletterten am Stamm
empor, verbargen uns tief atmend im Auslug, der uns sehr gefiel. Wir
fanden dort Flinten, Pistolen, Kisten mit Patronen. Und kaum hatten
wir uns ein wenig gekühlt und im Jagdstand eingerichtet, da klang
schon von der nächsten Kurve her heiser und herrschgierig die Hupe
eines großen Luxuswagens, der fuhr schnurrend mit hoher
Geschwindigkeit auf der blanken Bergstraße daher. Wir hatten schon die
Flinten in der Hand. Es war wunderbar spannend.
»Auf den Chauffeur zielen!« befahl Gustav schnell, eben rannte der
schwere Wagen unter uns vorbei. Und schon zielte ich und drückte los,
dem Lenker in die blaue Mütze. Der Mann sank zusammen, der Wagen
sauste weiter, stieß gegen die Wand, prallte zurück, stieß schwer und
wütend wie eine große dicke Hummel gegen die niedere Mauer, überschlug
sich und krachte mit einem kurzen leisen Knall über die Mauer in die
Tiefe hinunter.
»Erledigt!« lachte Gustav. »Den nächsten nehme ich.«
Schon kam wieder ein Wagen gerannt, klein saßen die drei oder vier
Insassen in den Polstern, vom Kopf einer Frau wehte ein Stück Schleier
starr und waagrecht hinterher, ein hellblauer Schleier, es tat mir
eigentlich leid um ihn, wer weiß, ob nicht das schönste Frauengesicht
unter ihm lachte. Herrgott, wenn wir schon Räuber spielten, so wäre es
vielleicht richtiger und hübscher gewesen, dem Beispiel großer
Vorbilder folgend, unsre brave Mordlust nicht auf hübsche Damen mit
auszudehnen. Gustav hatte aber schon geschossen. Der Chauffeur zuckte,
sank in sich zusammen, der Wagen sprang am senkrechten Fels in die
Höhe, fiel zurück und klatschte, die Räder nach oben, auf die Straße
zurück. Wir warteten, nichts regte sich, lautlos lagen, wie in einer
Falle gefangen, die Menschen unter ihrem Wagen. Der schnurrte und
rasselte noch und drehte die Räder drollig in der Luft, aber plötzlich
tat er einen schrecklichen Knall und stand in hellen Flammen.
»Ein Fordwagen«, sagte Gustav. »Wir müssen hinunter und die Straße
wieder frei machen.«
Wir stiegen hinab und sahen uns den brennenden Haufen an. Er war sehr
rasch ausgebrannt, wir hatten inzwischen aus jungem Holz Hebebäume
gemacht und lüpften ihn beiseite und über den Straßenrand in den
Abgrund, daß es lang in den Gebüschen knackste. Zwei von den Toten
waren beim Drehen des Wagens herausgefallen und lagen da, die Kleider
zum Teil verbrannt. Einer hatte den Rock noch ziemlich wohlerhalten,
ich untersuchte seine Taschen, ob wir fänden, wer er gewesen sei. Eine
Ledermappe kam zum Vorschein, darin waren Visitenkarten. Ich nahm eine
und las darauf die Worte: »Tat twam asi.«
»Sehr witzig«, sagte Gustav. »Es ist aber in der Tat gleichgültig, wie
die Leute heißen, die wir da umbringen. Sie sind arme Teufel wie wir,
auf die Namen kommt es nicht an. Diese Welt muß kaputtgehen und wir
mit. Sie zehn Minuten unter Wasser zu setzen, wäre die schmerzloseste
Lösung. Na, an die …


![[RSS]](../theme/image/rss.png)