Der erste Text war eine Rede, die Mühsam 1925 vor der ersten
Reichstagung der „Roten Hilfe Deutschlands“ gehalten hat. Der Text
passte auch, weil die Veranstaltung gestern von der modernen Roten
Hilfe veranstaltet wurde, und zwar im Rahmen von deren
Hundertjahrfeiern, die hier schon zuvor Thema waren.
Mühsam war gerade kurz zuvor aus einem bayrischen Knast rausgekommen, in
den ihn die Behörden von Weimar wegen seiner Unterstützung der
bayrischen Räterepublik von 1919 hatten stecken lassen. Der
Volltext der Rede (als PDF ohne Text) ist in Fraktur gesetzt; was an
daraus resultierenden OCR-Fehlern noch übrig ist, bitte ich großzügig
zu überlesen. Kursiv ist im Folgenden meine Moderation.
Erich Mühsam hat 1925 auf der ersten Reichstagung der Roten Hilfe ein
Referat gehalten, das zumindest im Inhalt sehr aktuell klingt,
jedenfalls für Menschen, die mal in Bayern demonstrieren waren.
Genossen und Freunde! Die Tagesordnung der gegenwärtigen Versammlung,
die uns zugestellt worden ist, enthält in Punkt 4, wahrscheinlich ohne
Absicht der Einberufer, aber doch mit einem tiefen Grund, eine
merkwürdige Unterscheidung, die sagt:
- der Strafvollzug in Theorie und Praxis,
- in Bayern.
Vieles von dem, was Mühsam im Folgenden berichtet, ist aus heutiger
Sicht ein bitterer Kommentar zu all den bürgerlichen Theorien [im
Blog: Exhibit 1, Exhibit 2] wie es dazu kommen konnte, dass
die Deutschen praktisch ihn ihrer Gesamtheit zu FaschistInnen
wurden. Wer Mühsam liest, wird sich noch mehr als ohnehin schon
fragen, woher wohl das Gerede von den "Extremisten von Links und
Rechts" kommt, die den blühenden Rechtsstaat Weimar demontiert
hätten.
Nein, es ist eher ein Wunder, warum ein derart von rechtsradikalen
Autoritären durchsetzter Apparat so lange gebraucht hat, um auch
formal die Macht an eine Partei wied ie NSDAP übergehen zu lassen.
Hören wir weiter Mühsam:
Ich muß mich darauf beschränken, vom Festungsstrafvollzug zu
sprechen, weil ich hier aus persönlicher trüber Erfahrung sprechen kann. Was
über den Strafvollzug in Zuchthäusern und Gefängnissen bekannt geworden
ist aus Berichten, die mir zugingen von Leuten, die ihn selbst erlebt haben,
die entweder auf die Festung zurückkamen oder mich später aufgesucht haben,
das erweckt den Eindruck, als ob im Zuchthaus Straubing und in den
Zuchthäusern Bayerns überhaupt gegen die politischen Gefangenen eine
wahre Hölle etabliert ist und ein Verfahren, wonach die politischen
Gefangenen schlimmer behandelt werden als die kriminellen, und zwar
grundsätzlich.
Soweit wir erfahren konnten, wird z.B. Alois Lindner, der Erhard
Auer verwundet hat, nachdem Arco Eisner ermordet hatte — und
Lindners Tat war bekanntlich ehrlos, während Arcos Tat als die eines
Ehrenmannes gefeiert wurde — so malträtiert, daß er zeitweilig seinen
Aufenthalt in der Irrenabteilung des Zuchthauses nehmen mußte. Dagegen
wird der Gefangene Makowski in einer Art behandelt, die ungefähr der
Behandlung eines Hilfsbeamten gleichkommt.
Zur Einordnung: Eisner war Regierungsschef der Räterepublik, und Graf Arco
hat diesen aus antikommunistischem Hass erschossen. Makowski wiederum
hat als Teil der protofaschistischen Freikorps bei der Niederschlagung
der Räterepublik 21 Männer niedergemetzelt, die noch nicht mal
Kommunisten waren, sondern „katholische Gesellen“. Und so (wieder
Mühsam) kam es,
daß das Gericht seine erste Aufgabe darin sah, festzustellen,
ob die Mörder glauben konnten, Spartakisten vor sich zu haben, oder ob sie
wußten, daß es sich tatsächlich um Katholiken handelte. Da man bei Makowski
und Müller unbedingt zu dem Schluß kommen mußte, daß sie wußten, wer
die Leute waren, bekamen sie hohe Zuchthausstrafen. Sie werden jetzt aber
besonders bevorzugt behandelt. […]
Umgekehrt haben sich die Regierungen in Berlin und München besondere
Mühe bei den Schikanen gegen die anderen Gefangenen, zumal
solche mit linkem Hintergrund, gegeben:
Es ist in diesen Anstalten Grundsatz — ich bemerke, daß das
allgemeiner Grundsatz in Bayern ist — daß die Bestimmungen, die den
Verkehr mit den Angehörigen regeln, keine Gültigkeit haben auf Bräute.
Die Bräute werden in Bayern nicht anerkannt, sie sind keine
Verwandten, und selbst Bräute, die bereits Kinder von ihren Männern
haben, und die nur aus irgendwelchen Gründen die Eheschließung nicht
vollzogen haben, werden als Bräute nicht anerkannt.
Auf der anderen Seite haben wir, wenn wirklich mal von der anderen
Seite einer ins Zuchthaus kommt, den Fall Zwengauer. Zwengauer ist
eines Fehmemordes überführt worden. Er wurde zum Tode verurteilt und
dann zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Er konnte aber nach
ganz kurzer Zeit, nach wenigen Wochen aus der Krankenabteilung des
Zuchthauses flüchten. In der bayerischen Presse hieß es: „Es hat den
Anschein, als ob er mit Hilfe von Strafvollzugsorganen geflüchtet
sei.“ Den Anschein hatte es für uns allerdings auch.
Von Links her ist in Bayern einem politischen Gefangenen die Flucht
noch nie gelungen. Selbst die Flucht aus Festungen ist seit Januar
1921, wo es einem meiner Freunde auf dem Transport zum Zahnarzt
gelang, aus dem Zuge zu springen, nicht mehr gelungen. Es wurde keiner
mehr zum Zahnarzt befördert.
Mühsam kommt jetzt genauer auf seine „Festungshaft“ zu sprechen.
Festungshaft war im Kaiserreich eine Art Hausarrest für Ehrenmänner –
etwa welche, die sich duelliert hatten – unter einem weit
großzügigerem Regime als in Gefängnis oder gar Zuchthaus. Für die linken
politischen Gefangenen der Weimarer Republik änderte sich das recht
schnell:
Als wir verurteilt wurden vom Stand- oder Volksgericht, da waren die
Urteile, die mehr durch Glücksfall auf Festung lauteten,
selbstverständlich ausgesprochen worden in der Voraussetzung, daß
nunmehr auch Festungshaft vollstreckt werden würde. Bei denjenigen,
gegen die man Zuchthaus wollte, wurde ausdrücklich gesagt, daß man
keine Festung haben wolle, und das Strafmaß für uns andere wurde
außerordentlich hoch angelegt mit Rücksicht darauf, daß die Strafe
leicht zu ertragen sei. Unter dieser Voraussetzung wurden bis 15 Jahre
Festung verhängt.
Da kam der Justizminister Dr. Müller (Meiningen), Demokrat in der
sozialdemokratischen Regierung Hoffmann, und brachte, nachdem wir
schon von Anfang an nicht in die eigentliche Festung, die dafür
gedient hatte, gelegt wurden, sondern in eine Abteilung des
Zuchthauses Ebracht, also in andere Räume, und nachdem uns schon von
Anfang an Ausgang nicht bewilligt wurde, obwohl er zur Festungshaft
gehört, nachdem uns sonst aber ein Festungsstrafvollzug, wie er üblich
war, zuteil geworden war — war im August 1919 einen Erlaß heraus, den
er Ausführungsbeftimmungen zur Hausordnung für Festungsgefangene
nannte. Diese Ausführungsbestimmungen hoben aber die Verordnung,
deren Ausführung sie auslegen sollte, absolut auf. […]
[Die bayrische Regierung kann danach] jeden Raum, der [ihnen] gefällt, dazu
bestimmen. Klar ist, daß das Gesetz für die Festungsgefangenen
bestimmt, daß sie in eigens dazu bestimmten, baulich dafür in Frage
kommenden Räumen unterzubringen sind und nicht in Räumen, die zu
Gefängnis- und Zuchthausstrafen eingerichtet sind.
Das kennen wir auch heute noch, von Sicherungsverwahrung – neulich war
Thomas Mayer-Falk hier in Heidelberg – und auch von Abschiebehaft
und ähnlichen Übergriffen.
Ich bin darauf eingegangen, weil von hier aus die ganzen Schikanen,
die ganzen Ruchlosigkeiten ihren Ausgang nahmen. Denn nicht nur, daß
wir in Gefängnissen und Zuchthäusern untergebracht waren, wir wurden
auch bewacht von ausgebildetem Gefängnis- und Zuchthauspersonal, die
den Unterschied zwischen der Festungshaft und der Gefängnis- und
Zuchthaushaft nicht machten. So geschah es und so war es auch die
Absicht.
[…]
Es ist ein uraltes Prinzip des Strafvollzugs, daß bei Beginn der
Strafe die Strafe schwer ist, daß die Gefangenen zuerst fest an die
Kandare genommen werden und daß allmählich ein Nachlassen dieser
Härten vor sich geht. Das ist ein Prinzip, wie es bisher überall im
Strafvollzug festgelegt ist. In Bayern wurde das umgekehrte Prinzip
gehandhabt. Es hat sich in einem Prozeß durch den Eid eines Beamten
der Festung St. Georgen herausgestellt, daß ein Erlaß bestand, wonach
Müller (Meiningen) verfügt hat: Die Festungshaft ist sukzessive zu
verschärfen. Und die Verschärfung hat fünf Jahre angedauert.
Franz Kafkas „Prozess“, geschrieben ca. 1914, erschien gerade in den
Tagen, als Mühsam seine Rede hielt. Es war Zeitgeist:
Die Verschärfungen wurden zur Kenntnis gebracht häufig einfach
durch Disziplinierungen. Man wurde in Einzelhaft genommen und wußte
dann, daß man das und das nicht tun darf. Fünf Jahre wurden wir so
gemartert. Das war schlimmer, als alles das, was ich später nur streifen
kann, da ich wenig Zeit habe. Ueberhaupt diese geheimen …
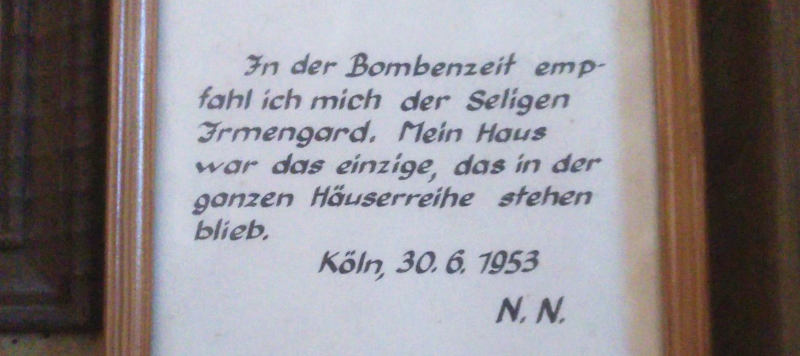
![Eine gerahmte Tafel in Frakturschrift, auf der u.a. steht: „Heilige Irmengard, du hast meinen Wunsch erfüllt […] Auf die Fürbitte der Seligen Irmengard wurde uns auffallend geholfen“.](/media/2026/irmengard-auffallend.jpeg)


![[RSS]](../theme/image/rss.png)




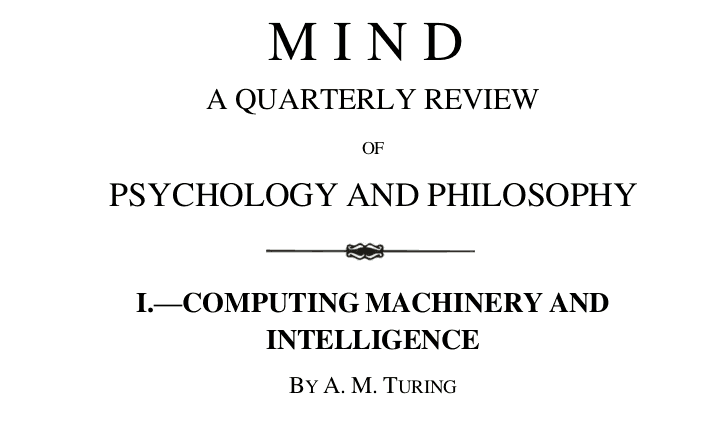
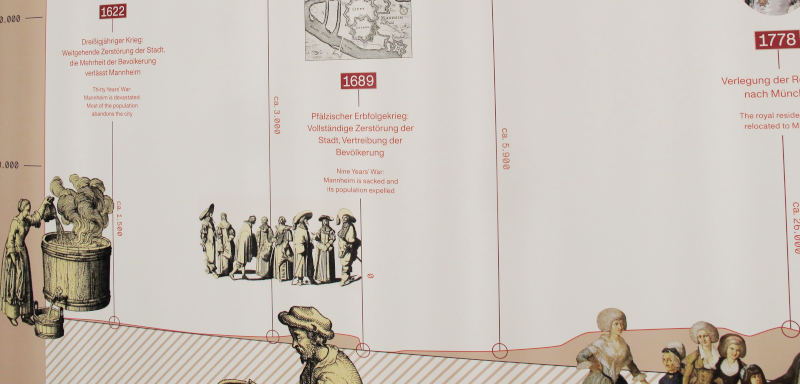
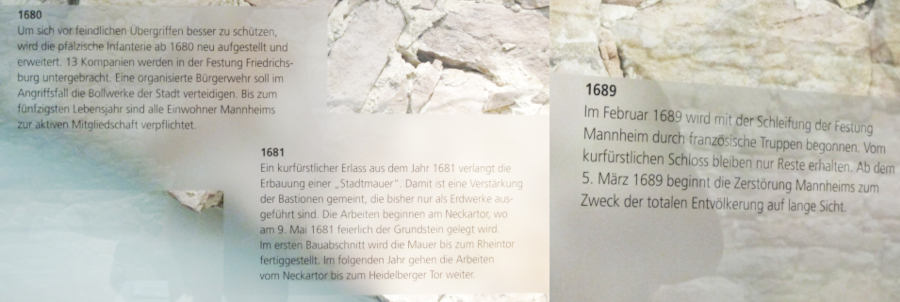
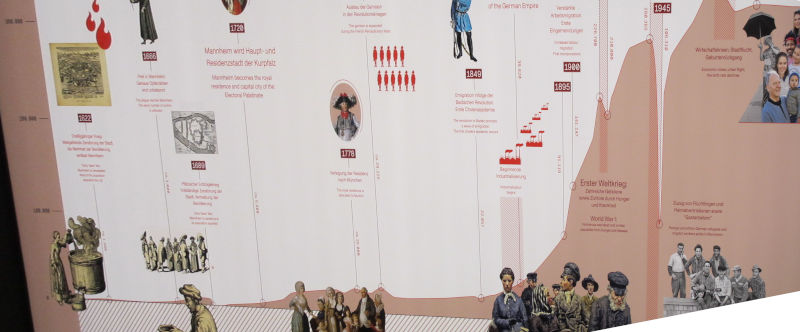






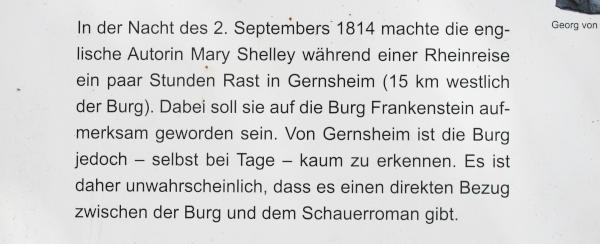



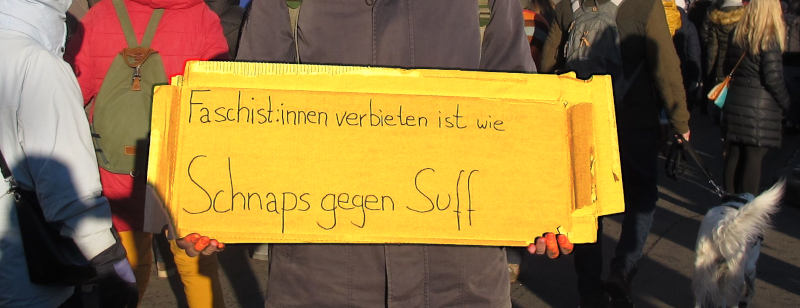









![Eine rostfarbene Strebe eines Güterwagens mit aufgesprühten weißen Buchstaben „DB Schenker Rail Automotive GmbH [...] Mail: dispo@dbschenker-atg.com“](/media/2023/dbschenker.jpeg)

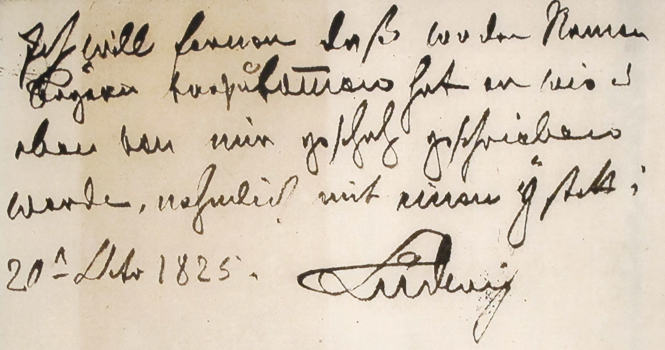
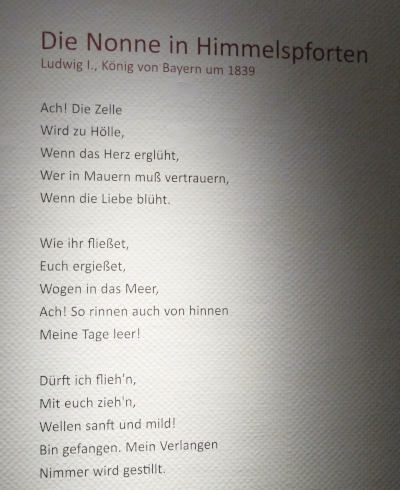







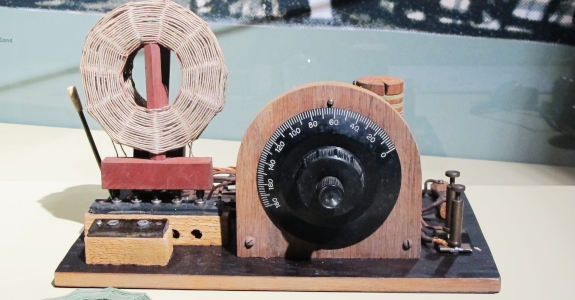





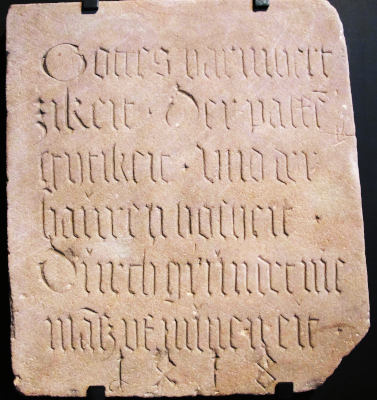
![Papier mit einer Guillotine-Zeichnung in der Mitte und darum in an Fraktur angelehnter Handschrift: „Roberts Piere ist nun tod/schönck den frieden uns O Gott/dieses winscht die ganze welt [...]](/media/2023/stras-robespierre-tot.jpeg)





