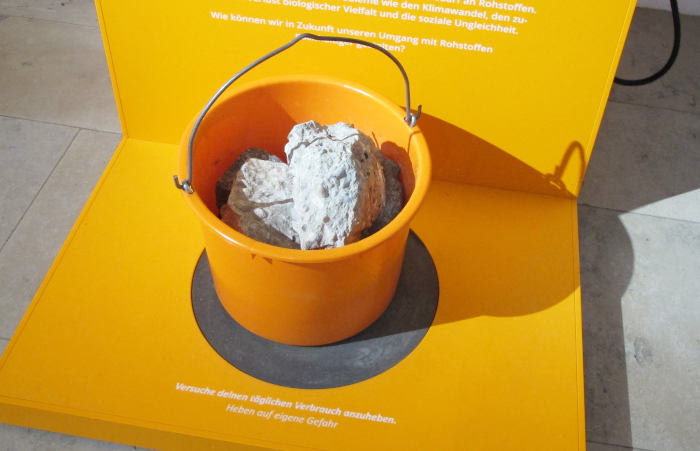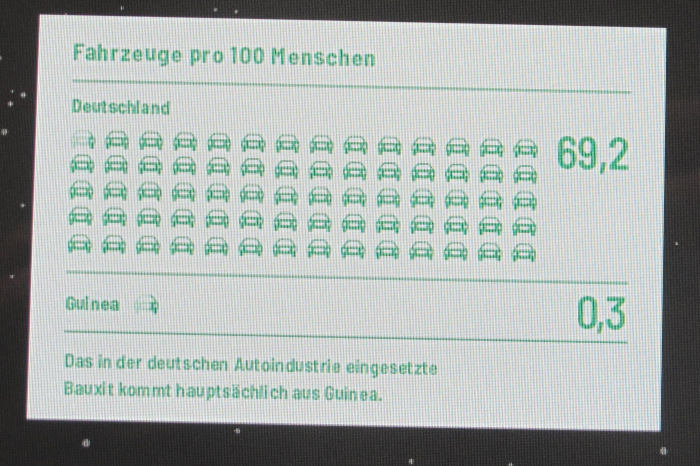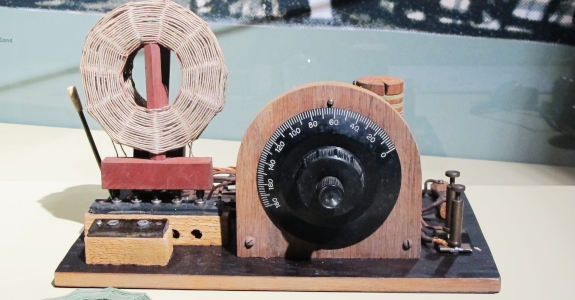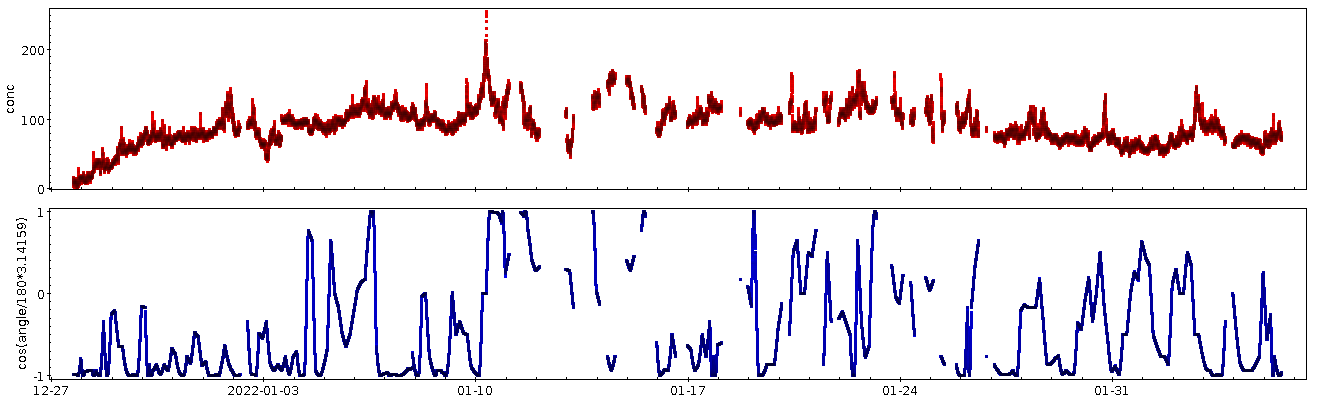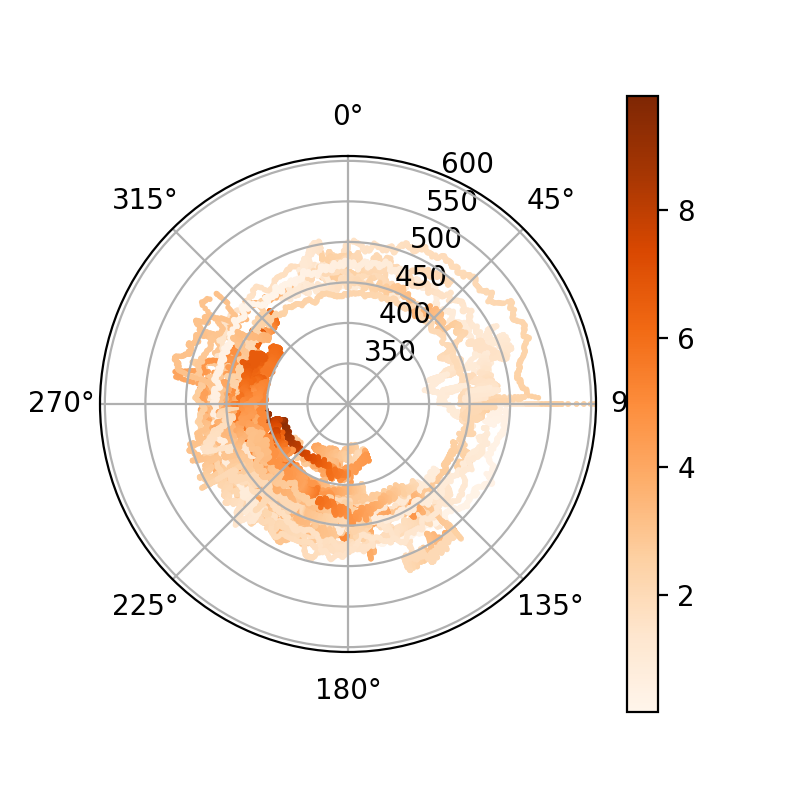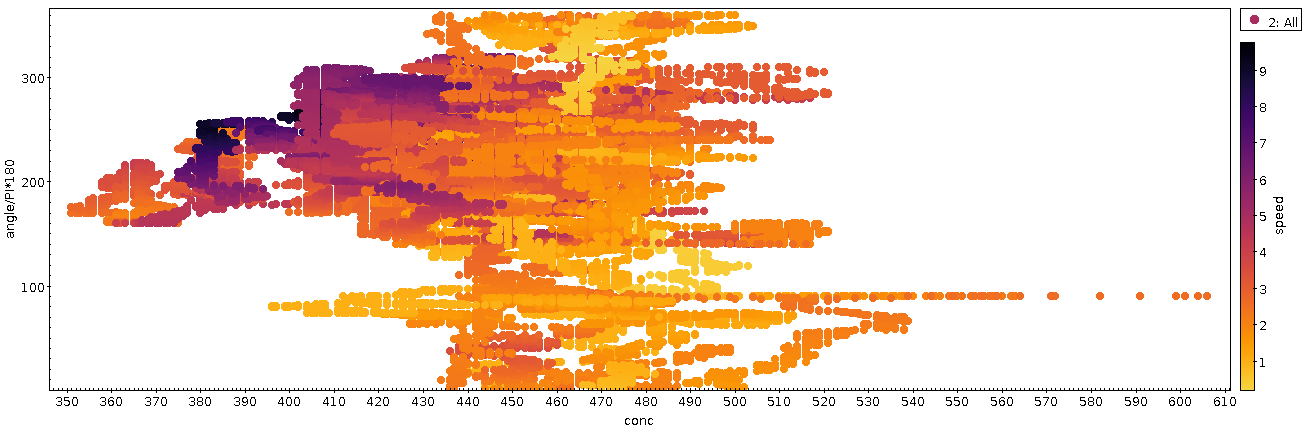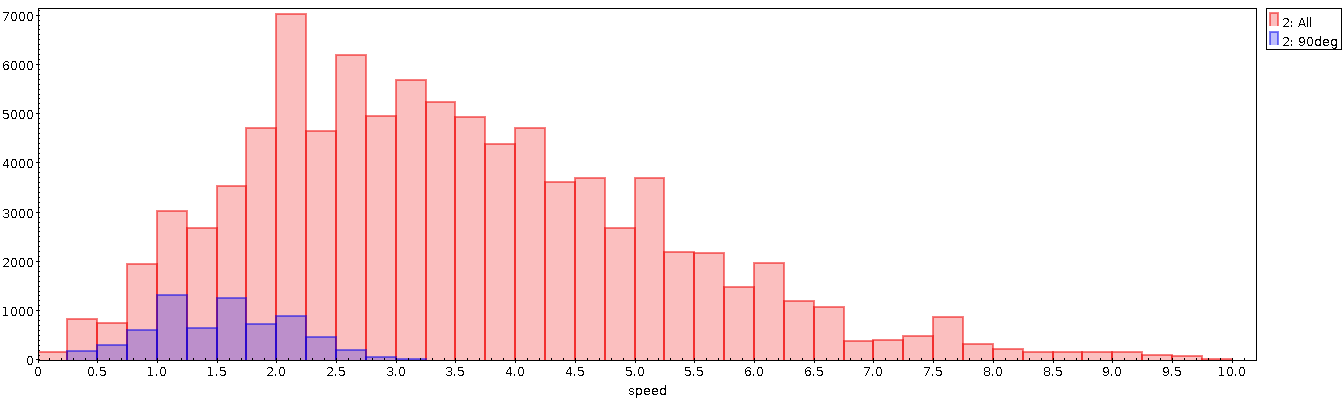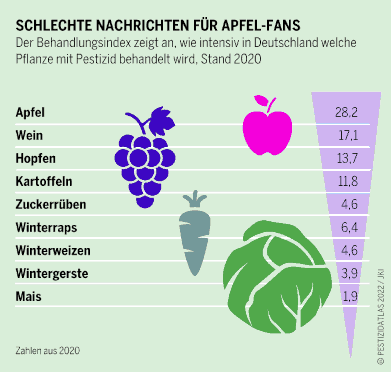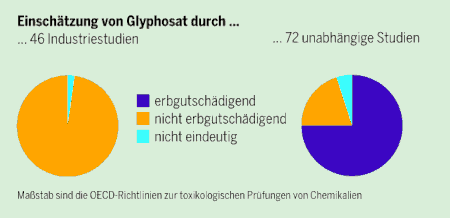Erfreulicherweise verschafft mir mein Museumspass auch im Landesmuseum
für Arbeit und Technik in Mannheim – Verzeihung, „Technoseum”,
inzwischen – freien Eintritt.
Da. Ich habe gleich damit aufgemacht: ich konnte das leicht bräsige
„Arbeit und Technik“ gut leiden, schon, weil es den historischen
Kompromiss der späten 1970er Jahre atmet. Ich stelle mir immer vor,
dass Alt-Ministerpräsident Späth damals eine Art Propagandaabteilung für
seine Daimler-Bosch-Spätzlesconnection bauen wollte, im seinerzeit noch
viel gewerkschaftsgeprägteren Mannheim dabei aber viele Zugeständnisse
machen musste. Wie viel Realität auch immer in dieser Fantasie stecken
mag: mensch kann noch heute die Internationale hören im Museum, bekommt
Einblick in die Elendsviertel der Gründerzeit und findet zwischen all
den Wunderwerken dann und wann auch Einsprengsel von
Technikfolgenabschätzung.
Vor diesem Hintergrund war ich bei meinem Museumspass-Besuch neulich
hocherfreut, dass ein paar der bunten „Zeitreise“-Klötze weiter an die
Gründerjahre des Landesmuseums erinnern. Auf ihnen leitet immer noch
ein Botschafter der späten achtziger Jahre in herzigen Videos in noch
fernere Zeiten:
Ihr habt geraten, was am Anfang des Texts zu sehen ist?
Aber eigentlich will ich ja verraten, was die Dinger im Foto oben sind.
Nämlich: Das sind verschiedene Maschinen, die erlaubten, Wechselklingen
für Nassrasierer zu schärfen und so deren Lebensdauer zu vervielfachen.
Das war erkennbar ein nenenswerter Markt, so zwischen 1900 und 1920.
Ich fand das bemerkenswert, weil zwar Rasierausrüstung aktuell
vermutlich bei fast niemandem nennenswert ökologischen Fußabdruck
ausmacht, das aber nur daran liegt, dass wir ansonsten so viel Dreck
machen. All die Sprays, Geräte, Wässerchen und Einweg-Klingenhalter,
die die breite Mehrheit der Menschen beiderlei Geschlechts mittlerweile
auf die Entfernung von Haaren verwendet, dürfte schon einige zehn Kilo
CO₂-Äquivalent im Jahr ausmachen – pro Nase. Das wäre
vermutlich schon im Prozentbereich des gesamten Fußabdrucks eines
Menschen von 1910 gewesen, wenn es sich nicht gerade um Fürstinnen oder
Soldaten handelte.
So gesehen betrachtet ihr oben eine der berühmten technischen Lösungen,
die uns bei der Bewältungung der Klimakrise helfen sollen, nur, dass die
Rede von der Innovation bei Kram aus dem Kaiserreich wirklich nicht
mehr passt [Pflichtmitteilung: Ich bleibe überzeugt, dass es für die
Klimakrise keine technische Lösung gibt; sie ist ein fundamental
wirtschaftliches, also soziales Problem und braucht daher auch soziale
Lösungen; im vorliegenden Fall schlage ich Großentspannung in Sachen
Körperbehaarung vor.]
Ich hoffe, mit diesen Blech- und Messingwundern aus der ausgehenden
Gaslichtzeit alle Steampunk-Fans des Internets hierher gelockt zu haben.
Herzlich willkommen, und wo ihr schon da seid, habe ich ein weiteres
Schmankerl aus dem Landesmuseum für euch:
„Turbodynamo II“ klingt wie albernes Technobabble aus Star Trek, ist
aber echt. Wenn ich das Arrangement richtig interpretiere, gehörte das
gute Stück zum Kleinkraftwerk, das die Waggonfabrik Fuchs – in einem
Produkt der Firma könnt ihr im Technoseum Dampfzug fahren – Ende des 19.
Jahrhunderts in Heidelberg hat errichten lassen. Die dazugehörige
Dampfmaschine wird im Landesmuseum normalerweise ein paar Mal am Tag in
Aktion vorgeführt, wenn auch mit anderswo erzeugtem Dampf, so dass
niemand Kohle schaufeln muss. Dennoch: Steampunks, kommt nach Mannheim.
Ein letztes Exponat habe ich noch zu bieten, und zwar eins aus der
aktuellen Sonderausstellung zur Geschichte des Rundfunks:
Das ist ein frühes Radio (ein Audion), das eine unbekannte Person im
Deutschland der 1920er Jahre gebaut hat.
Aus diesem Exponat habe ich Hoffnung geschöpft, denn es stellt sich
heraus, dass in dieser Zeit der Selbstbau von Radios bei Strafe verboten
war; der Grund war wahrscheinlich ein wenig, dass die Erhebung der
Rundfunkgebühr durch die Kontrolle des Gerätehandels erleichtert werden
sollte.
Doch versichert die Ausstellung, die Regierung habe sich vielmehr um
ausländische Spione besorgt, die durch Radiobasteln leichter mit ihren
Auftraggebern hätten kommunizieren können. Die Sorge war auch ganz
sicher berechtigt. Der Irrsinn aber, dass eine Obrigkeit aus Angst um
ihre Herrschaft ihren Untertanen das Basteln verbietet, der hatte hier
keinen Bestand, zumal größere Teile der Bevölkerung eben doch Radios
bastelten.
Der derzeit als Einbahnstraße erscheinende Weg zu immer mehr
„Sicherheitsgesetzen“ ist nicht unumkehrbar, schon gar nicht, wenn
hinreichend viele Menschen die unerfreulichen Vorstellungen der
Obrigkeit von „Sicherheit“ nicht teilen.
An der Stelle muss ich meine Prinzipien der Trennung von Arbeit und Blog
verletzen und eine Anekdote aus den späten neunziger Jahren erzählen.
Ich habe damals am ADS gearbeitet, einer großen Datenbank mit fast
allem, was in der Astronomie jemals wissenschaftlich publiziert wurde.
Weil damals die Leitungen über den Atlantik insgesamt in etwa die
Kapazität eines heutigen Haushaltsanschlusses hatten, unterhielten wir
Spiegel in etlichen Ländern, darunter auch in Frankreich.
Die französische Regierung jedoch – ich kratze die Kurve zurück zum
Thema – hatte damals ihrer Bevölkerung nennenswerte Kryptographie
verboten (kein Witz!), und so durfte das Institut, das den Spiegel
betrieb, auch keinen sshd laufen lassen (ich erfinde das nicht). Und
deshalb hatten wir für den französischen Spiegel extra irgendeinen
haarsträubenden Hack, um trotzdem irgendwie rsyncen zu können. Auch
dieser Unsinn ist ein paar Jahre später – längst hatte natürlich
praktisch jedeR Netzwerkende in Frankreich ssh, und überall
unterstützten auch Browser in Frankreich https – stillschweigend zu
Grabe getragen worden.
Erstaunlicherweise hat das Staatswesen die nicht mehr durch
Kryptoverbote gehemmten Umtriebe der Spione seitdem überlebt – und wenn
die Freie Kryptographie der Gesellschaft überhaupt einen Schaden
zugefügt hat, war der jedenfalls ungleich kleiner als, ich sag mal, die
Verheerungen durch Sarkozy, Hollande oder gar Macron.
Ihr seht: Obrigkeitlicher Zugriff auf die Technologiewahl ihrer
Untertanen ist kein Privileg von Kaisern oder mit Freikorps paktierenden
Reichspräsidenten. Das machen auch ganz regulär unsere – <hust>
demokratisch legitimierten – Regierungen. Aber Menschen, die in Zeiten
von Chatkontrolle und Hackertoolparagraphen leben, erzähle ich
damit wohl nichts Neues.


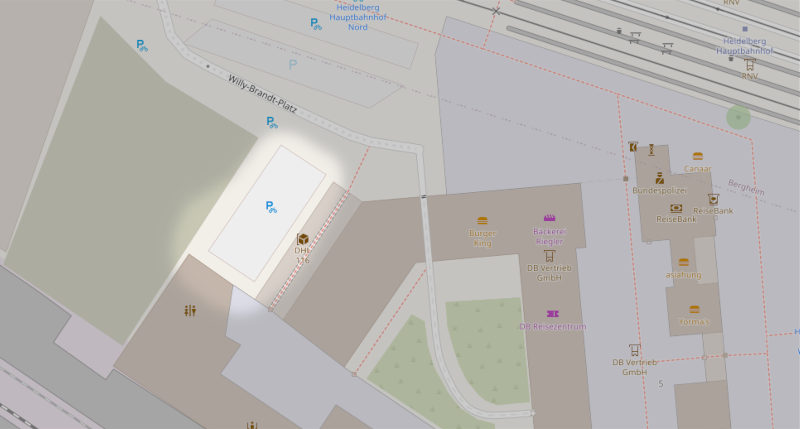
![[RSS]](../theme/image/rss.png)