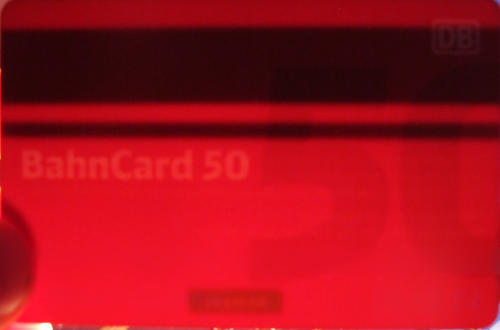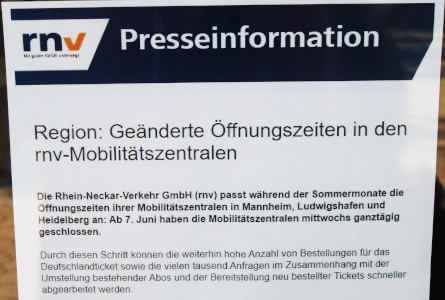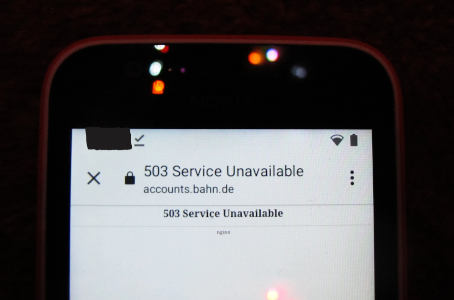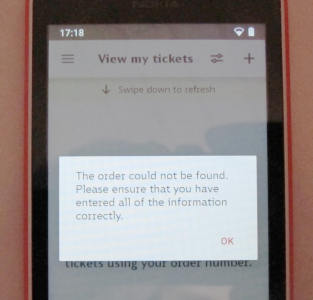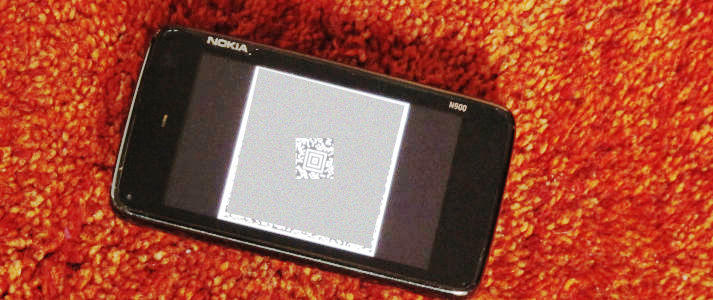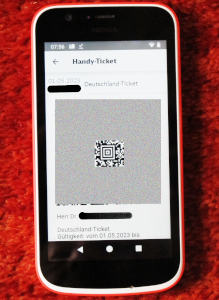Wenn Menschen miteinander reden, kann das verschiedene Gründe haben.
Sie können gemütlich plaudern, sie können sich beschimpfen, sie können
versuchen, sich Kram zu verkaufen – sie können aber auch einen Diskurs
führen, also Ideen austauschen, entwickeln oder kritisieren. Für die
letztere Funktion ist eine Sprache sehr hilfreich, die klar und präzise
ist, in der insbesondere Begriffe nachvollziehbare „Signifikate“ (also
Mengen von bezeichneten „Objekten der Anschauung oder des Denkens”) in
der wirklichen Welt haben.
Oft genug aber haben Sprecher_innen genau an Klarheit und Präzision kein
Interesse – ganz besonders, wenn von oben nach unten kommuniziert wird.
Herrschaft funktioniert besser, wenn den Beherrschten nicht ganz so
klar wird, dass ihr Wille, ihre Interessen, im Hintergrund stehen.
Dann sind plötzlich Begriffe hilfreich, die Gedanken verwirren, nicht
klären, die Informationen nicht übertragen, sondern zerstreuen.
„Globalisierung“ ist ein Beispiel oder auch „Arbeitgeber“, „Verantwortung“
„Terrorismus“ oder „Lernzielkontrolle“ sind weitere.
Für Begriffe, die so funktionieren, bin ich irgendwann mal auf den
Begriff Antisprache gekommen: So wie Antimaterie und Materie,
zusammengebracht, zu Strahlung reagieren, reagieren Antisprache und
Sprache zu... ach, ich hätte jetzt gerne „Verstrahlung“ gesagt, weil es
so gut passt, aber nein: letztlich Verwirrung.
Das Stück Antisprache, das (vielleicht gemeinsam mit „Populismus“) in
den letzten paar Jahren die steilste Karriere genommen hat, ist
„Digitalisierung”. Der Begriff ist fast nicht kritisiert worden,
jedenfalls nicht aus der Perspektive, was das eigentlich sei und ob das,
was da alles drunter fallen soll, überhaupt irgendwie zusammengehört.
Ich kann mal wieder nicht lügen: eine Motivation für dieses Blog war,
mal öffentlich dazu zu ranten.
Tatsächlich gehören die unzähligen Dinge, die unter „Digitalisierung”
subsumiert werden (die „Extension des Konzepts“ sagt der Semantiker in
mir) nämlich schlicht nicht zusammen. Noch nicht mal „halt was mit
Computern“ umfasst, sagen wir, Automatisierung in der Industrie,
Habituierung der Menschen an extern kontrollierte Ausspielkanäle von
Medien und Waren („smartphones“, „smart TVs“), Rechnernutzung in Bildung
und Ausbildung, Ausweitung des Netzzugangs, Sensoren aller Art in
politischer und sozialer Repression, die Wikipedia, Dauererfassung von
Herzfrequenz und Körpertemperatur, Open Access in der Wissenschaft und
„autonome“ Autos (was wiederum nur ein kleiner Ausschnitt von dem ist,
was mit „Digitalisierung“ schon so bemäntelt wurde. Weil ja da eben
auch tatsächlich freundliche und nützliche Dinge dabei sind, taugt auch
nicht mein zeitweiser Versuch einer Definition: „Digitalisierung ist,
wenn wer will, dass andere Computer benutzen müssen“.
Wenn das alles nichts miteinander zu tun hat, warum würde jemand all
diese Dinge in einen Topf werfen wollen, einmal umrühren und dann
„Digitalisierung“ draufschreiben? Und warum kommt das Wort eigentlich
jetzt, wo eigentlich so gut wie alles, was von Rechnereinsatz ernsthaft
profitiert, schon längst computerisiert ist?
Wie häufig bei Antisprache verbinden sich da verschiedene Interessen,
und am Anfang steht meist ein letztlich politisches Interesse an
Tarnung. Wer „Digitalsierung“ sagt, definiert Rechnereinsatz als
Sachzwang, und das ist saubequem, wenn mensch mit Leuten redet, deren
Arbeit dabei verdichtet wird, die enger überwacht werden, ihr Einkommen
verlieren oder ganz schlicht keinen Lust haben, noch ein Gerät um sich
zu haben, von dem sie nichts verstehen. „Digitalisierung“ klingt wie
etwas, das passiert, nicht wie etwas, das wer macht.
Ein Hinweis darauf, dass „Digitalisierung“ etwas mit der Durchsetzung
von EDV-Einsatz gegen unwillige Untergebene zu tun haben könnte, liefert
übrigens auch, dass der Begriff im deutschen Sprachraum so groß ist (und
warum es etwa auf Englisch kein „digitisation“ in vergleichbarer Rolle
gibt): es gibt hier ein vergleichsweise breites Bewusstsein für
Datenschutz (gelobt sei der Volkszählungsboykott der 1980er!), und je
klarer jeweils ist, was Leute jetzt mit Computern machen sollen, desto
mehr Widerstand gibt es.
Die Rede von „Digitalisierung“ kann also auch verstanden werden
als die Reaktion der verschiedenen Obrigkeiten auf das (vorübergehende?)
Scheitern von elektronischen Gesundheitskarten und Personalausweisen,
auf regelmäßige Rückschläge bei Kameraüberwachung an der Bäckereitheke
und Tippzählerei im Bürocomputer.
Die Erleichterung der Durchsetzung „unpopulärer Maßnahmen“ (mehr
Überwachung, mehr Komplikation, abstürzende Kühlschränke) durch
Vernebelung der tatsächlichen Gründe und Interessen ist ein generelles
Kriterium von Antisprache. Wo scheinbar kein realer Akteur etwas
durchsetzt, sondern ein unerklärbarer Zeitgeist weht, müssen auch diese
„Maßnahmen” nicht mehr begründet werden. Ganz besonders drastisch ist
das derzeit in den Schulen, denn eigentlich weiß niemand so recht, was
dort mit Computern in der Schule anzufangen wäre – jenseits von „wir
machen in Physik einen Zeitlupenfilm und berechnen aus den Einzelbildern
Momentangeschwindigkeiten“ habe ich da bisher noch nicht viel
Glaubhaftes gehört. Na ja, ok, und dann halt noch jetzt gerade als
Videotelefone, aber das hat natürlich außerhalb einer Pandemie für
keine_n der Beteiligten Sinn.
„Digitalisierung“ hat, wie viele andere Antisprache auch, einen Booster,
nämlich die trojanische Semantik. Dabei wird Kram, den wirklich keine_r
will, mit einer Hülle von Populärem umgeben. Beispielsweise ist
„Digitalisierung“ in den Hirnen vieler Menschen mit dem (für sie)
positiven Gedanken an ihr Mobiltelefon und die vielen schönen Stunden,
die sie mit ihm verbringen, assoziiert.
Wer nun offensiv stromkundenfeindliche Technik wie zeitauflösende
Stromzähler („smart meter“) durchsetzen will, kann auf weniger
Widerstand bei den künftigen Opfern hoffen, wenn sie diese „smart meter“
in einer Wohlfühl-Bedeutungswolke von TikTok und Tinder einhergeschwebt
kommen. Sie sind nicht ein Datenschutz-Disaster, die kommen mit der
Digitalisierung, sie sind doch nur ein kleiner Preis, den du für die
tollen Möglichkeiten zu bezahlen hast, die dein Smartphone dir bietet.
Das gehört auch etwas zur oben gestellten Frage, warum das Gerede von
„Digitalisierung“ gerade dann so anschwoll, als eigentlich alles, was
Rechner sinnvoll tun können, schon von ihnen erledigt wurde: Wenn die
Branche weiter wachsen will, dürfen ihre Kund_innen noch weniger als
zuvor danach fragen, wozu der autonom nachbestellende Kühlschrank
eigentlich gut ist. „Digitalisierung“ wäre dann die schlichte
Ansprache: Frage nicht nach dem Warum, denn alle machen jetzt
Digitalisierung, und wenn du das nicht machst, bist du ein
Bedenkenträger, der bald ganz furchtbar abgehängt sein wird.
Ganz falsch ist das bestimmt nicht. Aber auch nicht die ganze Wahrheit,
wofür ich neulich einen wunderbaren Beleg gefunden habe. Und der ist so
toll, der ist Material für einen anderen Post.
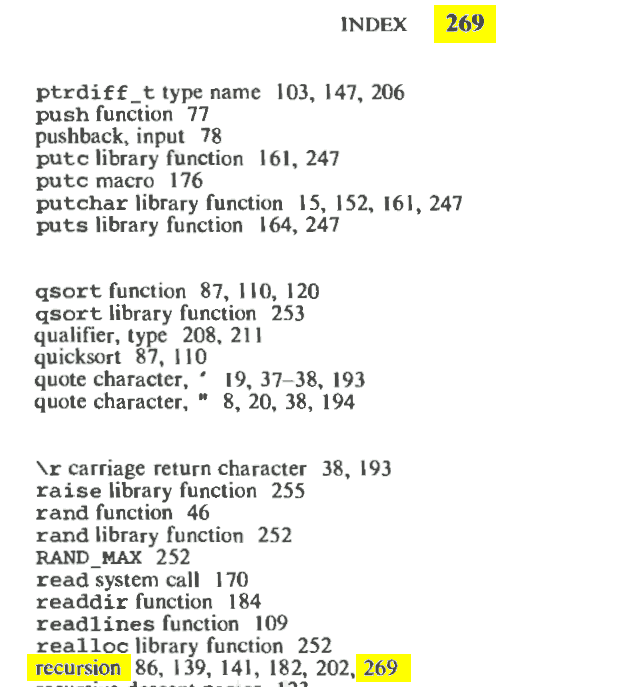
![[RSS]](../theme/image/rss.png)