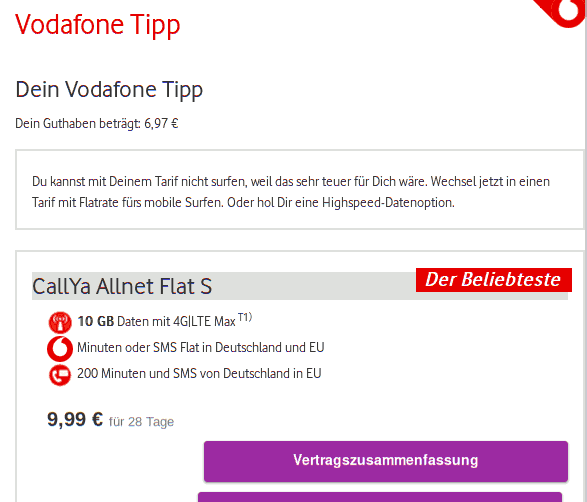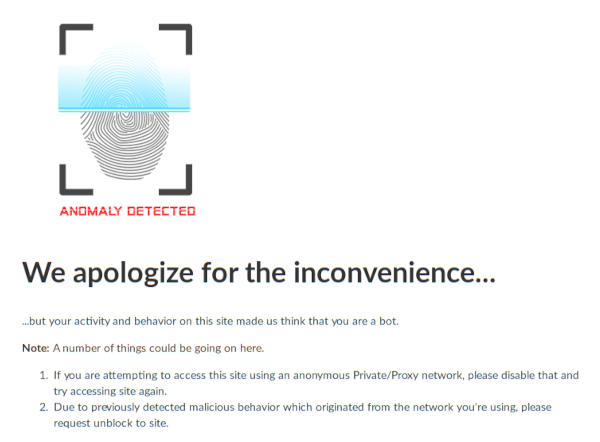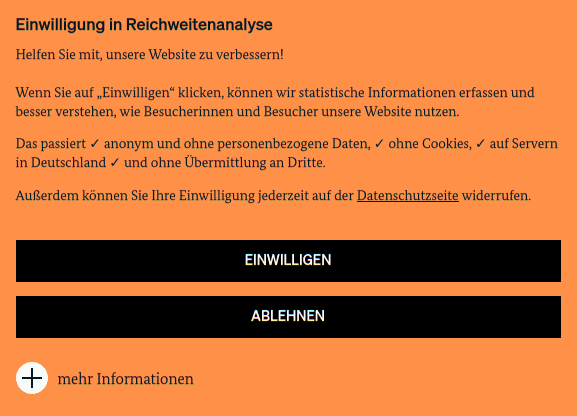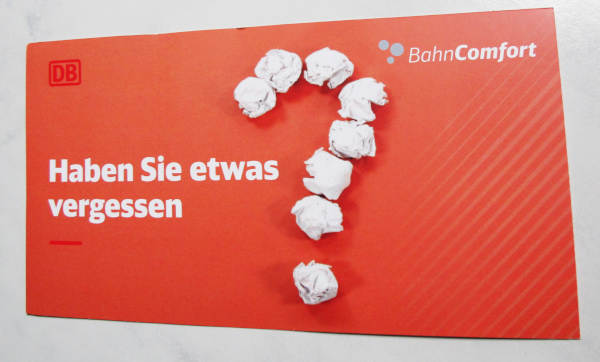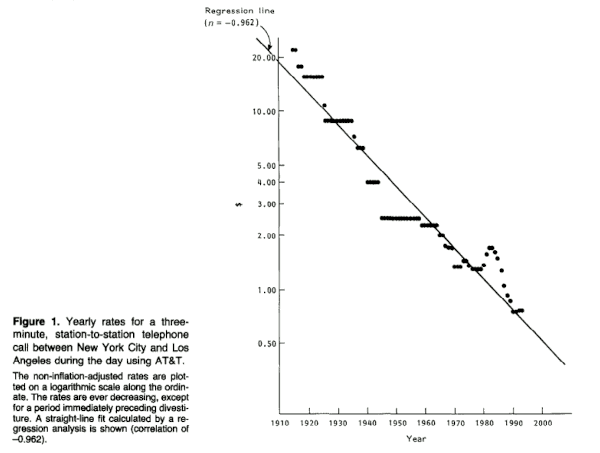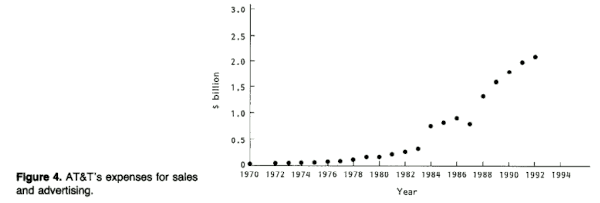Die Bahn verschickt ja dann und wann mal Gutscheine über einige Euro,
einzulösen für Fahrkarten innerhalb eines relativ knappen Zeitraums.
Ich zum Beispiel habe gerade einen über 15 Euro, der bis zum 30.11.
wegmuss – und ich kann ihn nur einlösen, wenn ich über 50 Euro verfahre.
Viele Gelegenheiten dafür gibts bei mir nicht mehr.
Leider würde dieser Gutschein nur auf der Webseite der Bahn
funktionieren, also weder am Automaten noch gar am Schalter.
Das war früher (wie in: bevor man „Digitalisierung“ machen musste) kein
schlimmes Problem. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich für
15 Euro in Einzelfällen durchaus bereit bin, meine natürliche Abneigung
gegenüber Marketing zu überwinden.
Digitalisierung ist, wenn Menschen, die keinen Bock drauf haben,
Computer verwenden müssen.
Inzwischen jedoch hat sich die Bahn digitalisiert. Digitalisierung
ist, ich habe schon mal drüber geschrieben, wenn alles außer Werbung
und Ausforschung kaputt ist. Jedenfalls, bis mensch es einmal aus- und
wieder eingeschaltet hat. So auch heute bei der Bahn, nur, dass ich die
nicht powercyclen kann.
Um halb neun versuche ich zum ersten Mal zu buchen. Ich muss ein
hCaptcha mit „Tassen mit Kaffee“ lösen. Ich füge mich: Für 15 Euro
mache ich ein Mal sogar so einen Scheiß. Nach erfolgreichem
Lösen (ob das wirklich immer Kaffee war in den Tassen? Wer weiß?)
bekomme ich aber nur ein „429 Too Many Requests“ von der Bahn.
Ich fluche und verfluche das giftige Geschenk der Bahn, zumal ich
schon ahne, was kommt, wenn ich einen Reload mache. Klar: ich bekomme
das nächste Captcha. Libellen. 7 Euro 50 pro gelöstem Captcha sind
allmählich schon unterhalb der Grenze meiner Käuflichkeit. Wird aber
sowieso nichts, denn „429 Too Many Requests“.
Um den Zorn auf das Bahn-Management etwas abkühlen zu lassen und den
Computer-Leuten der Bahn etwas Zeit zu geben, den Mist geradezuziehen,
beschließe ich, das um 11 Uhr nochmal zu probieren.
Digitalisierung ist, wenn es Werbung zeigt und dann abstürzt.
Ich lese meine Mails. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott
nicht zu sorgen, denn die Bahn schreibt:
Subject: Aktualisieren Sie Ihr Konto
Ihr Administrator hat soeben beantragt, dass Sie Ihr Deutsche Bahn-Konto
aktualisieren, indem Sie folgende Aktion(en) ausführen:
requiredAction.CONFIGURE_TWO_FACTOR_AUTH. Klicken Sie auf den untenstehenden
Link, um diesen Prozess zu starten.
https://accounts.bahn.de/auth/realms/db/login-actions/action-token?key=<691 byte base 64>
Wie bitte? Wozu soll ich mich Zwei-Faktor-authentifizieren, wenn ich
nicht mal ohne so Klimbim reinkomme? Warum bitteschön soll ich zum
Fahrkartenkauf in Zukunft ein Telefon brauchen, das mir Anweisungen
gibt, welche Zahlen ich in einen Computer zu tippen habe, damit die Bahn
sich herablässt, mein Geld zu nehmen?
Es geht hier ja wirklich nicht um Fort Knox oder die Codes der
Atombomben in Büchel, sondern allenfalls darum, dass mal wer auf meine
Kosten Zug fahren könnte. Das Risiko dafür schätze ich übrigens nach
20 Jahren elektronisch gekauften Bahnfahrkarten als im Wesentlichen
verschwindend ein, um so verschwindender, als die Bahn ja noch nicht mal
bona fide-KundInnen online Karten verkauft. Jedenfalls nicht mir.
Und dann, ganz ehrlich, Bahn: Ihr kriegt ja nicht mal mehr eure normale
Infrastruktur auch nur ansatzweise auf Reihe. Wie könnt ihr da
irgendeine Hoffnung hegen, etwas wie 2FA so hinzubekommen, dass das
nicht nur bei Neumond und Nipptide tut, was es soll?
Digitalisierung ist, wenn alles außer Werbung und Ausforschung kaputt
ist.
So ist auch das Ende der Geschichte absehbar. Ich bereue, dass ich
keinen Screenshot gemacht habe. hCaptcha ist weiter online, aber
offensichtlich im Spott-Modus: Kaninchen am Strand. KANINCHEN AM
STAND?!? Solche Witze finde ich nicht lustig, wenn ich gerade merke,
dass ich für fünf Euro pro Runde Tassen, Libellen und Kaninchen am Stand
angeklickt habe. Au weia. Baisse an der Börse, auf der meine Würde
gehandelt wird (einschlägiger Dilbert-Strip).
Die Pointe war wenig überraschend, dass auch das wieder nur auf ein 429
Too Many Requests führte. Am Bahnhof hingegen hatte ich meine Fahrkarte
am Automaten in ungefähr einer Minute, ganz ohne Captcha und 2FA, und
ganz ohne Versuchung, irgendeinen Marketingquatsch mitzumachen.
Ich war schon ein fanatischer Feind der Digitalisierung (also: Menschen,
die keinen Bock drauf haben, müssen Computer verwenden), sobald sie wer
erfunden hatte. Mein Fanatismus hat heute morgen viel Nahrung bekommen.
Und nein, nur weil der Fahrkartenautomat einen Computer hat und seine
NutzerInnen gelegentlich demütigt, ist er noch lang keine
Digitalisierung; dafür funktioniert er zu zuverlässig, schnüffelt zu
wenig und verlangt nicht von mir, Code von ihm unbesehen auf meinem
Computer laufen zu lassen.
Vielleicht fängt er an, Digitalisierung zu sein, wenn er erstmal
Werbespots zeigt, bevor er Karten druckt. Und dabei abstürzt.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)