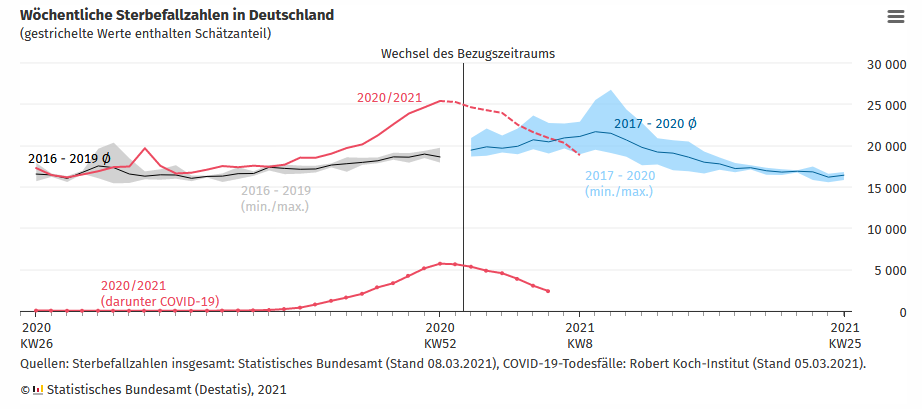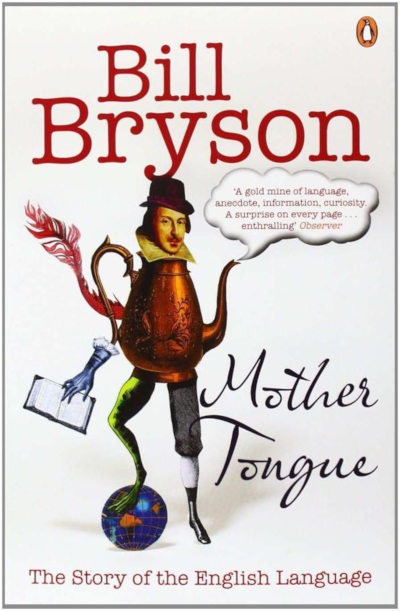Hörtipp: Wir müssen reden anno 2022
Treuen LeserInnen dieses Blogs wird nicht neu sein, dass ich dauerhaft wirklich schlechtes Gewissen habe, weil ich der patriotischen Filetierung Jugoslawiens durch meine nach der „Wiedervereinigung“ im Machtrausch delirierende Regierung nicht genug Widerstand entgegengesetzt habe und schließlich auch der Vorlage zur Sezession des Donbass im Wesentlichen nur fassungslos zugesehen habe (wenn auch mit Transparenten in der Hand).

Zum Beleg der „Transparente in der Hand“: Wohnortbedingt konnte ich gegen die Spätphasen des Kosovokrieges nicht in der BRD protestieren. Aber die Antikriegsdemo an der Bostoner Park Street Station am 25. März 2000 (ungefähr der erste Jahrestags unseres Überfalls) habe ich denooch mitgenommen.
Zur Rechtfertigung dieser Neuauflage alter Imperialismen haben die ApologetInnen der deutschen Politik die Geschichte vom „Völkergefängnis [als Begriff übrigens aus der Mottenkiste der rechten Feinde des ausgehenden Habsburgerreichs herausgeklaubt] Jugoslawien“ erzählt. Einen, wie ich finde, hübschen Kommentar dazu hatte der Deuschlandfunk Ende Dezember 2022: Wir müssen reden: Jugoslawisch.
Von Dingen überzeugt, die schwer zu glauben sind
Gleich am Anfang wird darin Vladimir Arsenijević zitiert:
Nach dem Zerfall von Jugoslawien wurden vier politische Sprachen geschaffen. In Bosnien-Herzegowina spricht man offiziell Bosnisch, in Montenegro Montenegrinisch, in Serbien Serbisch, in Kroatien Kroatisch, aber jeder, der bei klarem Verstand ist, weiß, dass es sich eigentlich um eine einzige Sprache handelt.
Jaklar, könnt ihr sagen, der ist ja, igitt, Serbe und macht da halt seine Großserbien-Sprüche; interessanterweise gibt es derzeit, vielleicht in so einer Logik, Wikipedia-Seiten über ihn auf Französisch, Katalan, Italienisch und sogar Kroatisch, aber nicht auf Deutsch. Ahem. Aber wenn wer, wie Arsenijević, sagt:
[D]as ganze nationalistische Projekt beruht darauf, dass Leute von Dingen überzeugt sind, die eigentlich schwer zu glauben sind.
…dann hat er_sie mein Herz gewonnen. Diese Vernunft auf der Seite „unserer“ Feinde steht übrigens in eklatantem Gegensatz zu Äußerungen „unserer” Verbündeter. Die ehemalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović fand – ebenfalls im DLF-Beitrag – die Proposition, es werde wohl schon die gleiche Sprache sein, wenn die Leute ohne Schwierigkeiten miteinander reden können, offensichtlich plausibel, aber unerträgich:
Diese sogenannte gemeinsame Sprache war ein politisches Projekt, das zusammen mit dem ehemaligen Jugoslawien untergegangen ist und es wird sie nie wieder geben.
Serbokroatisch als Kunstprodukt? Nur zu!
Ich will ihr geben, dass, wie sich auch im Laufe der Sendung herausstellt, auch Serbokroatisch ein Kunstprodukt ist, ganz wie Hochdeutsch, Italienisch und Französisch auch. In dem Sinn ist es tatsächlich auch ein politisches Projekt. Christian Foss von der HU Berlin wird im DLF zitiert mit:
Als Geburtsstunde einer gemeinsamen Sprache würde ich eigentlich das sogenannte Wiener Sprachabkommen von 1850 beurteilen, als sich serbische, kroatische und auch zwei slowenische Intellektuelle, Schriftsteller in einem Wiener Cafe trafen und eine Erklärung aufgesetzt haben, dass sie sich als ein gemeinsames Volk deklarieren, das eine gemeinsame Sprache brauche.
Das Programm war, eine einheitliche Schriftsprache zu schaffen, andere Dialekte aufzugeben, und das Interessante ist, dass dies, was auf absoluter Freiwilligkeit beruhte, tatsächlich funktioniert hat.
Nun: Bis Genscher und seine Freunde durchgeknallte Nationalisten vom Schlage eines Franjo Tuđjman dazu nutzten, die Sahnestücke Slowenien und Kroatien EU-tauglich aus Jugoslawien herauszulösen und den ungewaschenen Rest vergleichbar miesen Potentaten zu überlassen. Mensch stelle sich für einen Augenblick eine alternative Geschichte vor, in der die EU wirklich so nett ist wie viele ihrer BewohnerInnen glauben, eine EU, die all den PatriotInnen in den verschiedenen jugoslawischen Republiken gesagt hätte: „Ihr kommt nur entweder gemeinsam in die EU oder gar nicht. Also hört mit eurer scheiß-patriotischen Propaganda auf.“
Wie es stattdessen Anfang der 1990er aussah in den gerade erst auf deutschen Druck geschaffenen neuen Staaten, beschreibt in der DLF-Sendung eine Journalistin, die über den kroatischen Rundfunk berichtet:
Es gab eine richtig gehende Besessenheit, alle Worte, die irgendwie serbisch klangen, aus der Sprache zu tilgen und durch kroatische Ausdrücke zu ersetzen.
Wenn ich die Wahl habe zwischen einem politischen Projekt, das Feindschaften abbauen will und einem, das wie beschrieben Feindschaften schürt, dann liegt meine Sympathie klar bei ersterem. Wenn Leute wie Grabar-Kitarović dem ein Nie Wieder entgegenschwören, ist das ein schlimmes Drama.
Für kontraproduktive Umtriebe dieser Art existiert ein Begriff, der sogar ein Wikipedia-Kapitel hat: Sprachchauvinismus; unterhaltsamer ist der verwandte Artikel zu deutschem Sprachpurismus, der zahlreiche mehr oder minder amüsante Beispiele erwähnt, wie Menschen aus patriotischer Verwirrung das Lexikon verkomplizierten („Mundart“ statt des international verständlichen und ja trotz Mundart immer noch gebräuchlichen „Dialekt“ zum Beispiel) oder es jedenfalls versuchen (beispielsweise „Meuchelpuffer“ statt Pistole im Falle des 17.-Jahrhundert-Volksfans Philipp von Zesen).
A propos Volksfan: Im Sprachpurismus-Artikel habe ich gerade auch gelernt, dass das (glücklicherweise) immer noch verpönte „völkisch“ schlicht als sprachchauvinistischer Ersatz für das ja gerade leider wieder in Mode geratende „national“ vorgelegt wurde, und zwar erst 1875 von einem besonders unangenehmen Protofaschisten namens Hermann von Pfister-Schwaighusen (nun: seine eigene Wikipedia-Seite relativiert das „wurde“ zu „soll haben“, aber wenn die Geschichte nicht stimmen sollte, so ist sie doch zumindest gut erzählt.
Es gibt Hoffnung
Tja: Vielleicht hilft bei solchen Tendenzen KI? Es gibt ein Indiz dafür. Ich habe die DLF-Sendung nämlich wie hier beschrieben von Whisper transkribieren lassen, und die, hust, KI hat aus der Pointe der Geschichte um Tudjmans „Ich freue mich“-Begrüßung für den damaligen US-Präsidenten Clinton und seinen darin verwendeten (vermeintlichen) Serbizismus das hier gemacht:
Das Problem ist: sretchan ist serbisch, auf kroatisch heißt es sretchan.
Dass meine „KI“ da nicht zwischen „Serbisch“ und „Kroatisch“ zu unterscheiden vermag, würde ich als Hinweis auf kulturellen Fortschritt werten.
Noch mehr Hoffnung weckt jedoch die Geschichte der Kinder aus der bosnischen Kleinstadt Jajce, die für gemeinsamen Unterricht demonstriert haben. Vladimir Arsenijević berichtet von dort:
Wochenlang sind sie auf die Straße gegangen. Ihre Forderung: Sie wollten zusammen in die Schule gehen. Sie hatten Transparente, auf denen sie Birnen und Äpfel gemalt hatten. Ich habe das erst nicht verstanden, und dann haben sie es mir erklärt: Als der Kantonminister für Bildung gefragt wurde, warum er die Segregation im Bildungssystem nicht abschafft, hat er geantwortet, man könne Birnen nicht mit Äpfel mischen.
Wenn Menschen, die derartigen Überdosen patriotischen Unsinns ausgesetzt waren wie die Opfer deutscher Großmachtpolitik am Balkan, wieder zur Vernunft kommen können, dann gibt es noch Hoffnung.
![[RSS]](../theme/image/rss.png)