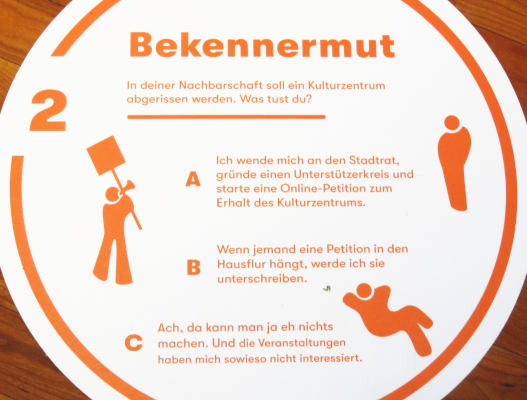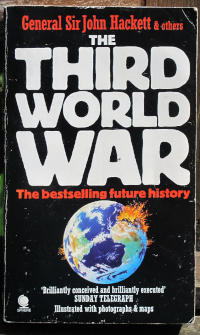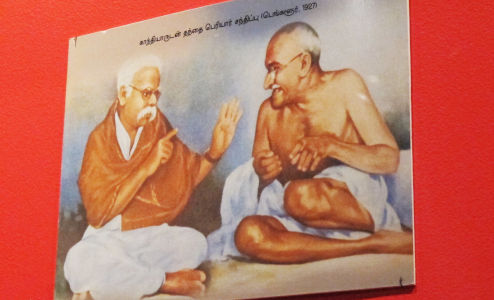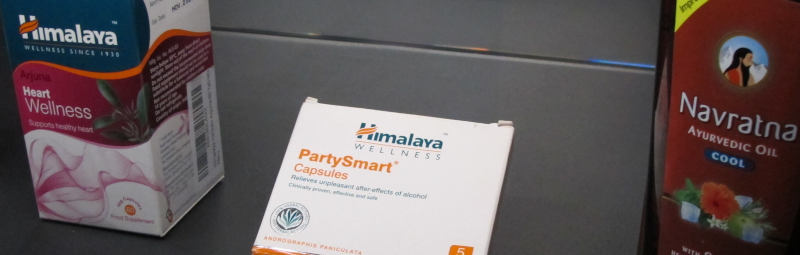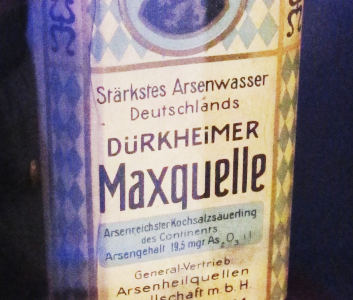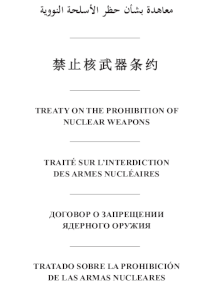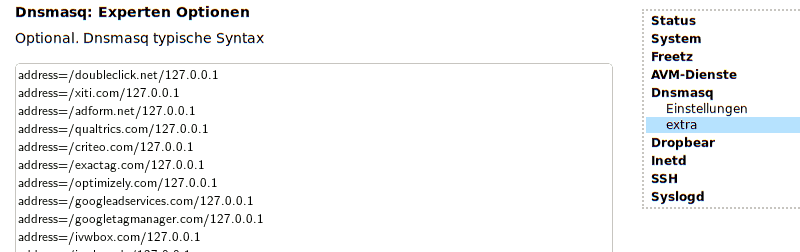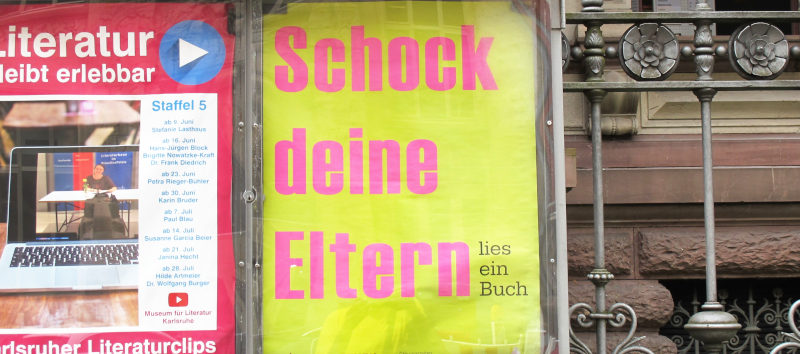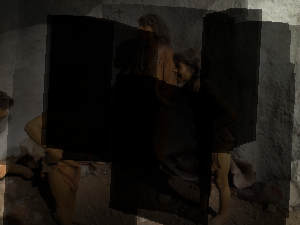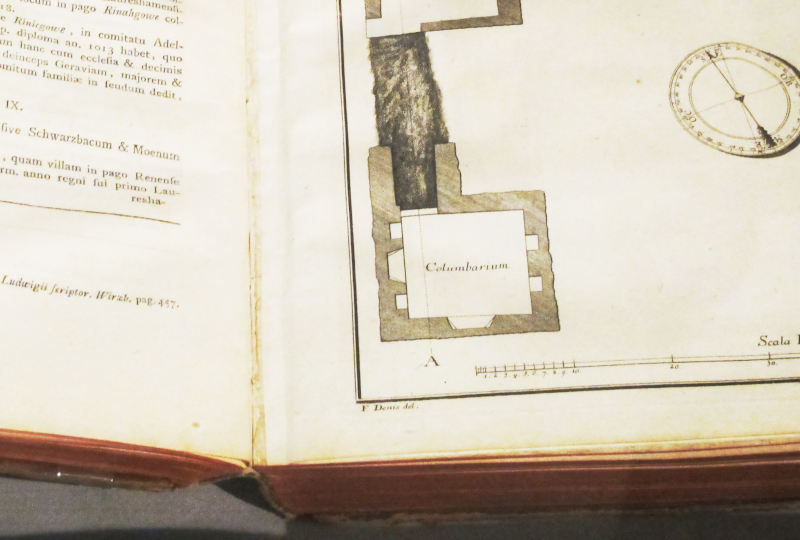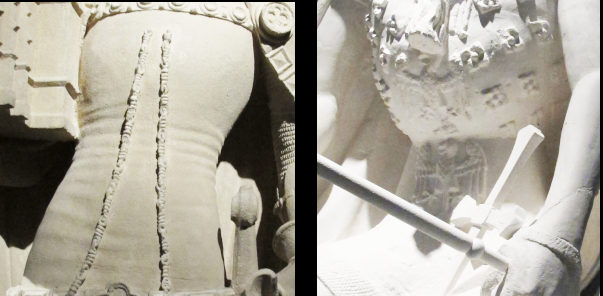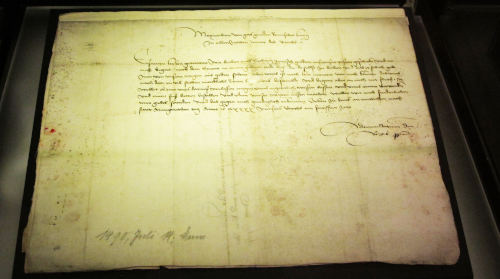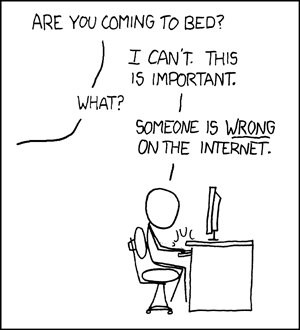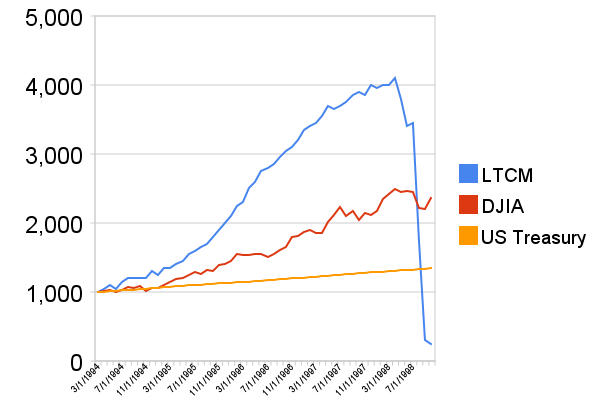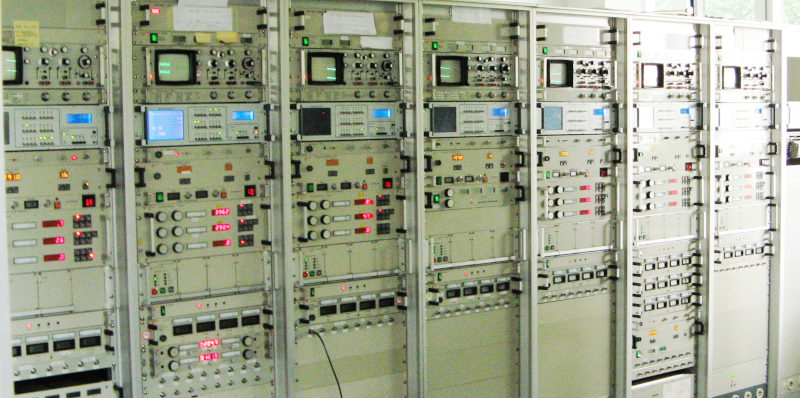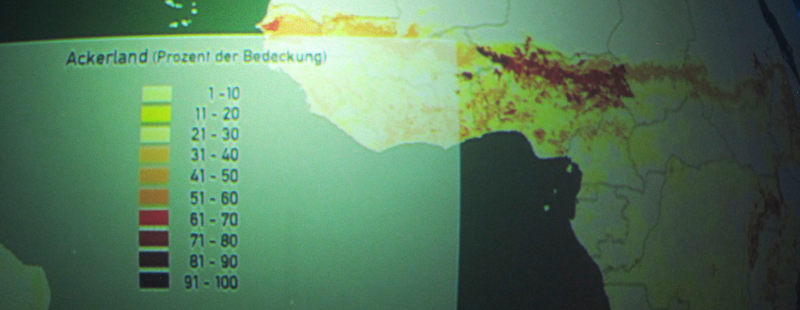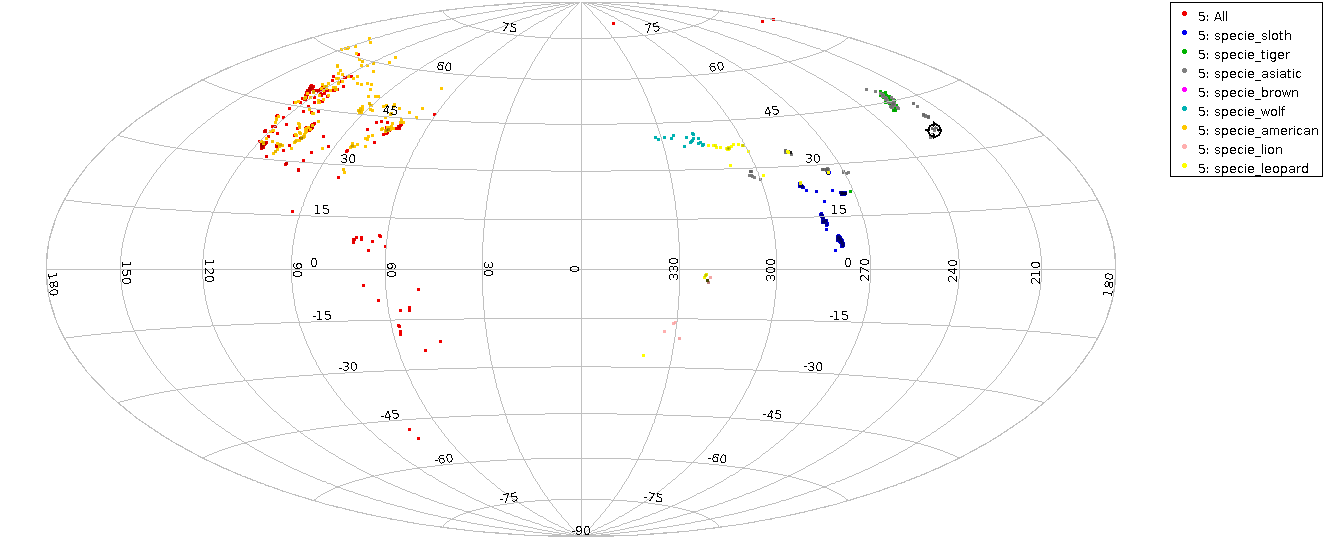Ich war seit gestern in anderer Sache in Bonn, hatte dabei aber Zeit für
einen mittel-langen Blick in das „LVR LandesMuseum Bonn“. Das wollte
ich gerne, denn erstens wusste ich, dass dort die Überreste des
originalen Neandertalers liegen, und zweitens bin ich im Rahmen meines
Römerfimmels schon einige Male auf „Original im LVR LandesMuseum Bonn“
(oder diverse Varianten der flamboyanten Schreibweise)
gestolpert.
Tatsächlich habe ich von den Exponaten, die im Wikipedia-Artikel zum
Museum erwähnt sind, nicht viel gesehen, denn die Leute bauen gerade
eifrig um. Dafür bin ich aber auch umsonst reingekommen, und zumindest
der Ur-Neandertaler war am Platz – die gefundenen Knochen ebenso wie
eine rekonstruierte Figur.
Letztere hatte nichts mehr von den gebeugten, haarigen Kreaturen, die noch
vor wenigen Jahrzehnten das Neadertaler-Bild prägten. Der
Steinzeitspeer in der Hand musste jedoch offenbar noch sein, obwohl
doch Verbandszeug viel besser zur Befundlage passen würde. Der
Ur-Neandertaler hatte nämlich ausweislich der nachgebliebenen Knochen 20
Jahre vor seinem Tod eine ziemlich schwere Armverletzung, und dass er
danach so lange überlebt hat, wird als eindeutiger Beleg für
Krankenversorgung und Fürsorge unter NeandertalerInnen gewertet.
Eher noch beeindruckender fand ich aber die keltische Abteilung des
Museums, in der Folgendes ausgestellt ist:
Das ist nicht etwa ein Diorama des gallischen Dorfes von Asterix und
Obelix. Nein, es ist ein Diorama, das die archäologischen Erkentnisse
zum gallischen Dorf von Niederzier-Hambach reflektiert. Genauer war
dort eine eburonische Siedlung, die
(vermutlich) im Rahmen der caesar'schen Angriffskriege im östlichen
Gallien 54 bis 51 vdcE aufgegeben wurde.
Weil sie so prima in unsere Zeit passt, lasst mich kurz ein Destillat
dieser Geschichte im Geiste meiner Betrachtungen zu Chios erzählen:
Um 57 vdcE ließen die eburonischen Herrscher ihre Untertanen mit Caesars
Truppen Belger abmetzeln. Doch schon zwei Jahre später empfanden sie
das römische Winterlager irgendwo in der Nähe ihrer Hauptstadt
(„Atuatuca“; kein Mensch weiß heute mehr, wo das überhaupt war) als
unerträgliche Kränkung nationaler Gefühle. Sie brachten also die Römer
irgendwie dazu, aus ihrem Kastell auszurücken. Als sie das geschafft
hatten, ließen sie ihr Militär angreifen, das, so Caesar, 10'000
römische Soldaten umbrachte.
Die, ach ja, „Offensive“ erwies sich mittelfristig als unklug, denn
Caesar konnte sowas nicht auf sich sitzen lassen. Er selbst bezichtigt
sich im de bello gallico des, ach ja, „Genozids“. In den aktuellen
Worten der Wikipedia:
Die Einwohner wurden niedergemetzelt, die Gehöfte
eingeäschert, das Vieh weggetrieben. König Catuvolcus starb durch
Suizid (53 v. Chr.), König Ambiorix konnte mit knapper Not über den
Rhein zu den Germanen entkommen. Über sein weiteres Schicksal ist
nichts bekannt. Archäologisch lässt sich für die Zeit um 50 v. Chr. in
eburonischen Siedlungen tatsächlich oftmals ein Siedlungsabbruch
erkennen.
Auch in der Darstellung im Landesmuseum werden Zweifel geäußert, ob nun
die Römer die EburonInnen wirklich alle abgemurkst haben; der gute
Zustand der Reste von Niederzier-Hambach und auch das Fehlen eines
Brandhorizonts lassen vermuten, dass hinreichend viele EburonInnen klug
genug waren, sich auf keine weiteren Kriegshandlungen einzulassen und
schlicht davongerannt sind. Etwas in dieser Art schlägt auch der
Bericht von Strabo vor, der so um die christliche Epoche herum von den
Eburonen wieder als Verbündete Roms spricht. Dennoch:
Bioarchäologisch ist nachweisbar, dass nach den römischen Feldzügen der
Wald das eburonische Land zurückgewann. Oh Grusel.
Wo gerade die Rede von Ambiorix war: Nicht nur die gallischen Dörfer
sehen offenbar so aus wie halt gallische Dörfer, also die bei Uderzo und
Goscinny. Die Leute scheinen auch so zu heißen. Ambiorix,
Vercingetorix, Verleihnix. Im Landesmuseum gab es dazu eine These, die
ich, so glaube ich, zuvor noch nicht gehört habe. Und zwar sei die
Namensendung -rix eigentlich ein -rigs, was wiederum mit dem
lateinischen Rex, König zu vergleichen sei. Ambiorix sei dann also
„König der Ambiorer“, Asterix vielleicht „König der Sterne“. Obelix…
oh, nee, ich mache jetzt keine Witze über mögliche Sprachfehler.
Nach dieser Deutung kämen die zahlreichen auf -rix endenden Namen in der
Überlieferung einfach daher, dass die klassische Geschichtswissenschaft
im Wesentlichen von Königen und ihren Untergrobianen redet. Mir
hingegen ist viel sympathischer der relativ neue Trend (ich linke dazu
auf Arno Borst, 1925-2007) der Archäologie, das wirkliche Leben zu
betrachten. Dabei können so (mich) verblüffende Ergebnisse herauskommen
wie: Die Römer hatten Klappmesser. Nehmt etwa dieses her:
Das ist ein Fund aus dem Grab der „Schönen von Zülpich“, und die
MuseumskuratorInnen wundern sich ein wenig, was wohl so ein Taschenmesser
in einem Frauengrab macht. Ein wenig sexistisch fand ich das schon, in
jeder Richtung; denn soweit ich das sehe – die Römer haben ihre Toten ja
bis zur christlichen Machtübernahme durchweg verbrannt, so dass es kaum
DNA-Evidenz geben wird –, wird die These des Frauengrabes im
Wesentlichen nur durch Beigaben von Spiegel, Kamm und Cremes gestützt,
die zumindest ausgehend vom modernen Befund durchaus auch von Männern
genutzt werden.
Und selbst wenn die Tote weiblich war, sind Taschenmesser wirklich recht
unabhängig von Geschlechtszuschreibungen nützlich; stellt euch alleine
mal vor, wie lausig die kaum gezüchteten Orangen der römischen Zeit zu
schälen gewesen sein werden. Nur, weil unser Patriarchat
Frauen Klappmesser lieber vorenthält (schon dadurch, dass Frauenkleidung
wenigstens vor dem Zeitalter großer Telefone meist keine
messergeeigneten Taschen hatte), heißt das ja noch nicht, dass das
römische Patriarchat das auch so gehalten hat.
Jedenfalls: Dann und wann bin auch ich noch überrascht über den Stand
der Technik in den römischen Provinzen. Das gilt vielleicht noch mehr
für den Klappstuhl der „Priesterin von Borschemich“:
Das rostige Zeug links ist in einem Grab einer Anhängerin, vielleicht
sogar einer Priesterin, einer der zahlreichen orientaloiden Kulte des
kaiserzeitlichen Roms gefunden worden, und die Museumsleute haben mich
davon überzeugt, dass das schicke Teil rechts eine zuverlässige
Rekonstruktion des Originalzustands ist; wer vor Ort ist und das rostige
Zeug genauer ansieht, dürfte, so erwarte ich, diese Einschätzung
schließlich teilen.
TIL: Die Römer hatten Campingmöbel. Vielleicht haben sie die zu
kultischen Zwecken eingesetzt, aber vielleicht ist das bei uns auch
nicht so viel anders.
Zum Schluss muss ich etwas besorgte Kritik loswerden, und zwar an diesem
Ausschnitt aus dem „Stammbusch“ des Menschen, der in der Nähe des
Neandertalers zu finden ist:
Zunächst ist das schon ein wenig moderner als die
Anno-Darwin-Anthropologie, denn die verschiedenen Homo-Arten mischen
sich in diesem Bild zum modernen Menschen (der durchgezogene senkrechte
Strich ganz rechts), und der Neandertaler steht nicht mehr als tumber,
unterlegener, rausdarwinierter, toter Ast da. Das ist schön.
Zumindest in eine möglicherweise nicht so schöne Ecke geht das
allerdings im breiteren Kontext. Auf der grauen, oberen Fläche steht
nämlich außerhalb des gewählten Ausschnitts „Europa“, auf der unteren,
blasstürkisen „Afrika“. Und so könnten Menschen das als Teilrevision
der in konservativen Kreisen immer noch gerne als kränkend empfundenen
Out of Africa-Theorie ansehen. Jaja, so könnte mensch hier lesen,
Homo sapiens ist schon in Afrika entstanden, aber zum ordentlichen Homo
sapiens sapiens ist er erst geworden, als er es nach Europa geschafft
hat und dort dem hellhäutigen Neandertaler zum letzten Schliff verholfen
hat. Wenn das die Intention dieser Grafik sein sollte, würde ich
erstmal (also: bis irgendwer sehr starke Belege bringt, dass die Homo
sapiens, die seinerzeit aus Afrika ausgerückt sind, nicht schon fertige
moderne Menschen waren) sagen: Nicht so schön.
Die beeindruckende Animation der Ausbreitung der verschiedenen
Homo- und Australopithecus-Arten während der vergangnen paar Millionen
Jahre, die rechts von diesem Stammgebüsch an der Rückwand der
Neandertaler-Halle läuft, gibt das dicke Linie-dünne Linie-Verhältnis in
dieser Darstellung ebenfalls überhaupt nicht her. Dort ist pures Out
of Africa zu sehen. Tatsächlich besiedeln (erobern?) in deren
Darstellung moderne Menschen West-, Süd- und Ostasien, lange bevor sie
sich ins kalte Europa wagen.
Dennoch: das Landesmuesum in Bonn kann ich warm empfehlen, auch während
der Umbauarbeiten. Ob mensch danach noch ohne Geld zumindest in die
Dauerausstellung kommt: Das hätte ich wohl erfragen sollen. Habe ich
aber nicht gemacht.
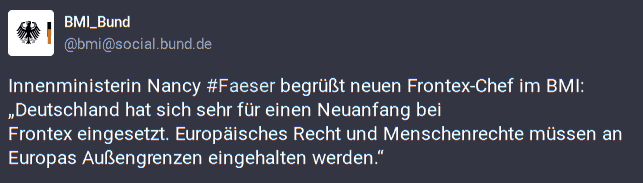
![[RSS]](./theme/image/rss.png)