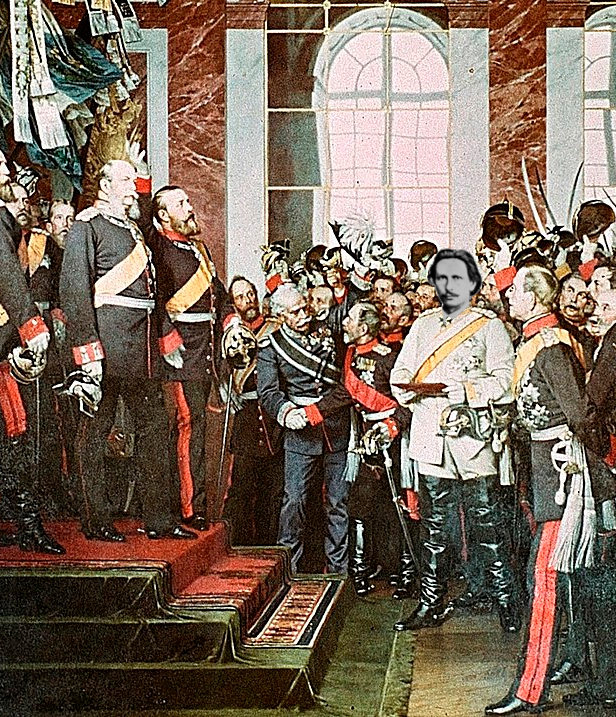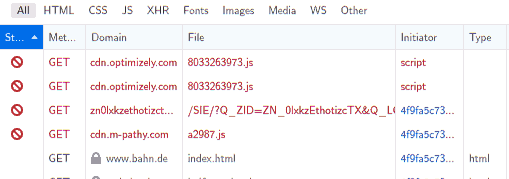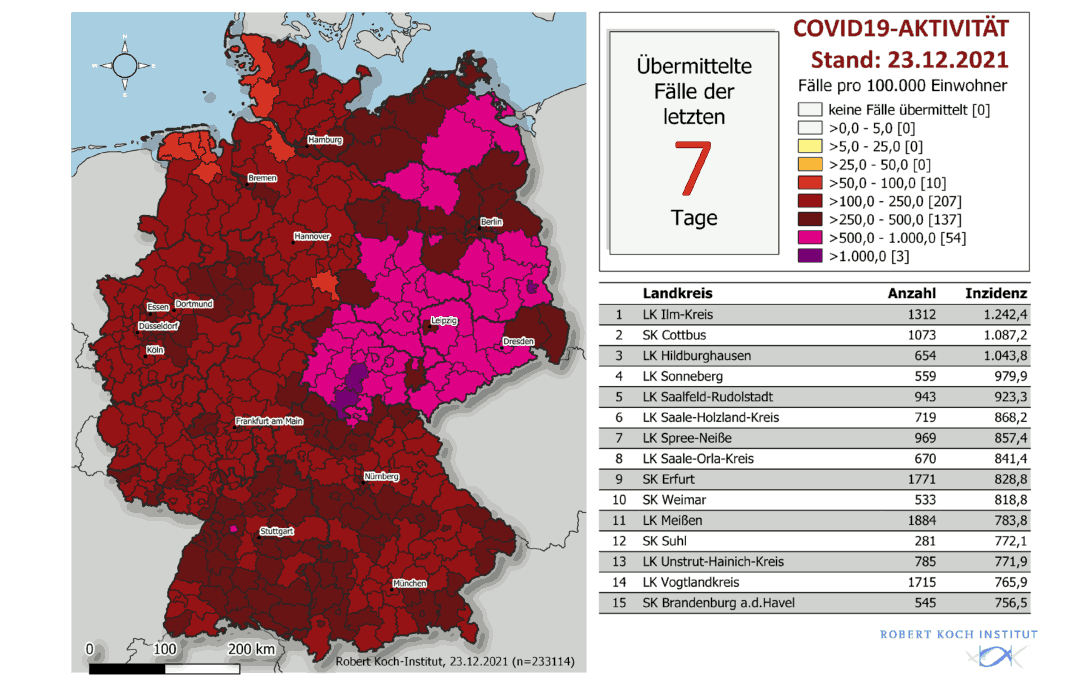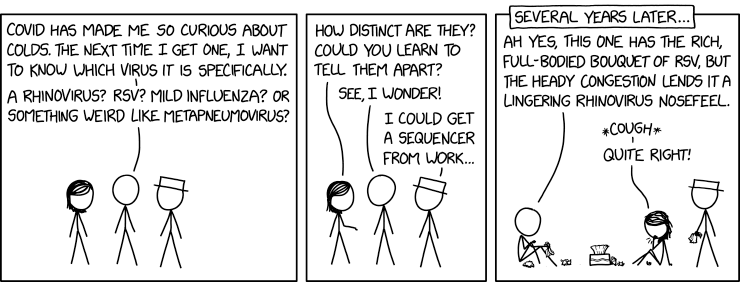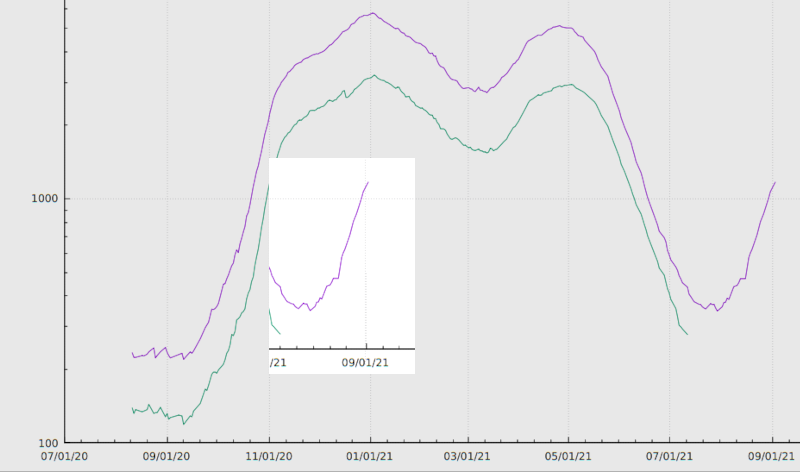„Extremismus“ ist sozusagen die Mutter aller Antisprache, Sprache also,
die entworfen ist für Kommunikation, die bei gelungenem Sprechakt bei
den EmpfängerInnen Information zerstört statt bildet.
Entsprechend viele haben sich um Abrüstung des Begriffs (und der
verwandten „Hufeisentheorie“) bemüht. Schon 2007 etwa schloss sich die
Grüne Jugend der damals populären Strömung „gegen jede
Extremismustheorie“ an (Abschnitt 9.1 im damaligen Selbstverständnis)
– gerade bei denen bemerkenswert, denn 14 Jahre später werden die Leute,
die das damals geschrieben haben, allmählich in die Parlamente gekommen
sein, die die Etats der Inlandsgeheimdienste („Verfassungsschutz“, VS)
abnicken.
Das ist relevant, denn ohne den VS gäbe es ziemlich sicher gar keinen
„Extremismus“. Diese These ist weniger steil als sie klingt. Als
ersten Hinweis biete ich mal, dass zu keiner Zeit mehr Gerede über
„Extremismus“ im Blätterwald raunt als gerade jetzt, wo der Bundes-VS
mal wieder seinen „Bericht“ (ich wollte nicht „Kampfschrift“ schreiben,
aber Bericht ohne Anführungszeichen fand ich jetzt auch nicht treffend)
vorgestellt hat.
Tatsächlich haben mich schon neulich zwei Nachrichten inspiriert,
endlich mal einen Antisprache-Post über das E-Wort zu schreiben.
Erstens hatte der Deutschlandfunk am 9. Juni:
Die russische Justiz hat mehrere Organisationen des inhaftierten
Kremlkritikers Nawalny endgültig verboten. Ein Gericht in Moskau
stufte die Vereinigungen als extremistisch ein.
und dann, am 10. Juni:
Das [hessische] Landeskriminalamt durchsuchte die Wohnungen und
Arbeitsplätze von sechs Mitgliedern des Spezialeinsatzkommandos. [...]
Ermittler waren den Angaben zufolge im Rahmen einer anderen
Untersuchung zufällig auf die rechtsextremen Handynachrichten
gestoßen.
Was haben Nawalny und die hessischen Polizisten mit Nazineigungen
gemeinsam? Gemeinsam mit, sagen wir, den Leuten, die den Weiterbau
des offensichtlichen Irrsinnsprojekts A49 im Dannenröder Forst
verhindern wollten und die auch unter dem Label „Extremismus“ in den
Fokus der Geheimdienste wie unter Polizeiknüppel kamen?
Nur eines: Sie sind den jeweiligen Regierungen ernsthaft unangenehm.
Das, und nichts anderes, ist die eigentliche (für weiter unten:
„wissenschaftliche“) Bedeutung von „Extremismus“.
Gut, die meisten Leute, die von „Extremismus“ reden, geben sich große
Mühe, von dieser Bedeutung abzulenken. Die sinnzerstörende Wirkung
entfaltet das Wort tatsächlich nur, wenn das diffuse Grauen im Angesicht
von Nazi-Polizisten, die quälen, wen sie als „Ausländer“ oder Linke
einschätzen gegen die netten Leute vom Danni eingesetzt werden kann
(oder halt, wenn ihr Putin seid, gegen Querulanten wie Nawalny). Und
das ist wichtig, denn gerade die Danni-Leute (und in Russland
wahrscheinlich eben auch eine Figur wie Nawalny) werden von allen außer
den betonköpfigsten Schurken geliebt. Ohne den Aufruf von Bildern
blindwütig mordender IS-Gläubischer (oder muttermordender Nazispinner
aus Hanau) ist robuste staatliche Reaktion – sagen wir, wochen-
(Danni), monate- (auch Danni) oder jahrelanges (Nawalny, nochmal
Danni) Wegsperren – in solchen Situationen in der Öffentlichkeit
schwierig zu verkaufen.
Nettes und Fortschrittliches mit Fiesem und Reaktionärem verrühren und
damit diskreditieren: Das ist die Nettowirkung des Extremismusbegriffs.
Wenig überraschend kommt er genau aus der fiesen und reaktionären Ecke,
nämlich aus den damals noch intensiv von Altnazis durchsetzten
Verfassungsschutzbehörden. Anfang der 1970er Jahre machten sie sich
erkennbar Sorgen, weil die allgemeine Sympathie für die unter anderem
durch die aufkommenden Berufsverbote gepeinigten „Radikalen“ (so hießen
die damals; vgl. Radikalenerlass) in dem Maß zunahm, wie die Avantgarde
von 68 gesellschaftlicher Mainstream wurde. Da musste was Neues her,
zumal der ähnlich verrührende „Totalitarismus“, der gegen
realsozialistische Umtriebe noch prima – und noch dazu mit erheblicher
Plausiblität – zog, für kiffende Blumenkinder und wenig später bunte
HausbesetzerInnen offensichtlich nicht passte.
Und so wurde der „Extremismus“ im Bericht des BfV von 1973 geboren –
wobei ich vermute, dass es international Vorbilder gegeben haben wird.
Wenn nicht, würde inzwischen sogar Wladimir Putin dem deutschen
Inlandsgeheimdienst nachplappern. Ich kann gar nicht so genau sagen,
warum ich diesen Gedanken besonders furchtbar finde.
Bis heute wird „Extremismus“ als Konzept wie als Wort vom VS genährt.
Die scheinbare Glaubwürdigkeit eines so eindeutig antisprachlichen und
breit kritisierten Begriffs in der heutigen Zeit wird erzeugt von
Männern wie Armin Pfahl-Traughber, Eckhard Jesse und Uwe Backes, die aus
dem Umfeld von Geheimdienst und politischer Polizei in die Akademia
aufgestiegen sind und dort VS-Berichte durch Zitate adeln – VS-Berichte,
deren krudes politisches Gerüst sich umgekehrt auf die aggressive
Scheinwissenschaft der genannten Herren (und noch einer Handvoll
weiterer) aufbaut. Diese zirkuläre Legitimation funktioniert
immerhin so gut, dass taz-Autor Volkan Ağar in der taz von heute dem
Bundesinnenministerium vorwirft, der Bundeszentrale für politische
Bildung vorgeschrieben zu haben, eine „wissenschaftliche
Linksextremismusdefinition“ durch eine des VS zu ersetzen. Der
„Wissenschaftler“, zu dessen Produkten übrigens BMI und Bildzeitung
selbst die bpb zuvor genötigt hatten: Armin Pfahl-Traughber. Au weia.
Wie geht es besser? Nun, wie immer: Hinschauen und sagen, worum es
wirklich geht. Die PolizistInnen des Frankfurter SEK sind eklig nicht,
weil sie der Regierung peinlich sind, sondern weil sie RassistInnen
sind, autoritäre Positionen vertreten, vielleicht AntisemitInnen sind –
wer weiß, nachdem ja statt konkreter Information bisher nur
„Rechtsextremismus“ im Raum steht? Wäre es nicht wirklich hilfreich,
wenn klar wäre, ob es da auch groben Sexismus geht, ob nur um den
üblichen Autoritarismus („die Polizei sind die Guten“) oder ob dort auch
preppermäßige Putschpläne ausgeheckt wurden?
Fängt mensch an, solche Fragen zu stellen, zeigt sich auch bald, warum
das autoritäre Establishment den „Extremismus“ so sehr präferiert
gegenüber dieser Sorte von Hinschauen: Jemand wie Seehofer vertritt
offensichtlich erznationalistische Positionen (wenn er sich etwa über
Abschiebungen zum Geburtstag freut), Leute, die 2% des
Bruttoinlandsprodukts fürs organisierte Töten ausgeben wollen, sind klar
MilitaristInnen („Lasst uns Menschen töten, um meine Interessen
durchzusetzen“), und wer meint, „Hasskriminalität“ durch mehr Befugnisse
für die Polizei beikommen zu können, dürfte sehr offen für autoritäre
Gedankengänge sein (eine wirksamere Alternative wäre z.B., die
Bildzeitung unrentabel zu machen, die, soweit ich als Vertreter offener
Standards das sehe, weit mehr für die Verbreitung von Hass tut als alle
Facebook-Trolle zusammen). All diese Dinge sind kritikabel, sogar
unappatitlich, führen bei konsequenter Umsetzung in gefährliche Nähe von
Faschismus – und nichts davon bewegt sich irgendwo dort, wo der VS
„Extremismus“ sieht.
Die Leute im Danni hingegen wollen glaubhaft größtmögliche Befreiung vom
Auto. Sowohl Befreiung als auch weniger Autos sehe wohl nicht nur ich
sehr gerne. Und so geht das auch mit vielen anderen „Linksextremismen“:
Von Deutsche Wohnen-Enteignung über die Auflösung von NATO und VS über
entschlossenere Schritte gegen den Klimawandel und das Massensterben im
globalen Süden bis zu grundsätzlicherer Kritik an unseren
Produktionsweisen sind die meisten Anliegen sehr gut nachvollziehbar,
immer mit dem Herz, sehr oft auch mit dem Hirn. Ohne „Extremismus“
bräuchte es Argumente gegen diese Anliegen. Und die sind entweder
schwer zu ersinnen oder entlarvend für die Anliegen der Gegner.
Ohne „Extremismus“ leben heißt mithin zu fragen, was Leute wirklich
wollen und nachzudenken, wie weit das Freiheit, Gleichheit und
Solidarität (oder was immer mensch nun als Leitplanken annimmt)
voranbringt – oder die jeweiligen Gegenteile.
Klar, das ist im Regelfall viel mehr Arbeit (insbesondere auch als der
schlichte Verweis „vom VS beobachtet“), aber so ist das mit der
intellektuellen Ehrlichkeit. Und genauso klar, häufig sind die
Ergebnisse nicht so ganz eindeutig, wie etwa bei Alexei Nawalny. An
sich mag mensch ja Sympathien hegen für Menschen, die Herr Putin
anstrengend findet; ich fürchte aber, angesichts von Nawalnys
tatsächlichen Überzeugungen, die kaum weniger autoritär wirken als die
der KremlparteigängerInnen, bleibt allenfalls generelle Solidarität
gegen Repression übrig als Motivation, ihm irgendwie beizuspringen.
Nach diesen Worten ist ein Blick in die DLF-Presseschau von heute
besonders ernüchternd: Selbst der Süddeutsche, deren Heribert Prantl
sich nach dem Auffliegen des NSU den Forderungen nach Auflösung des VS
angeschlossen hatte, gelingt allenfalls milder Spott im Angesicht
überkritschen Masse von Antisprache im „Bericht“ des
Inlandsgeheimdienstes. Alle anderen extremisieren („rechts wie links“
die beim Verbreiten von VS-Material unvermeidliche NOZ, „die Demokratie
[und natürlich nicht wie schon seit Jahrzehnten Nichtkartoffeln, Punker
und Penner] angegriffen“ beim Tagesspiegel, „Facebook, Telegram & Co
[und selbstverständlich nicht Bildzeitung und VS selbst]“ als
Jaucheschleudern bei der Südwest-Presse, „Militanz nimmt auch in der
linksextremistischen Szene zu“ bei der Mitteldeutschen Zeitung) als gäbe
es kein Morgen. Seufz.

![[RSS]](../theme/image/rss.png)