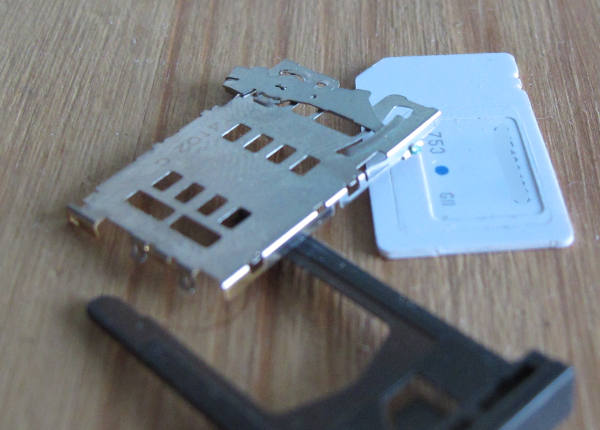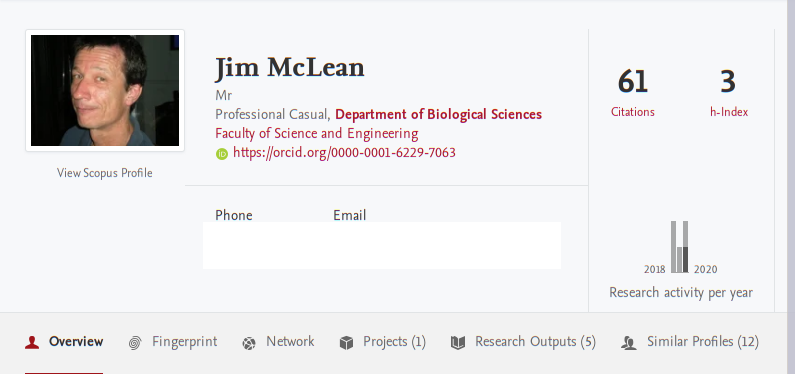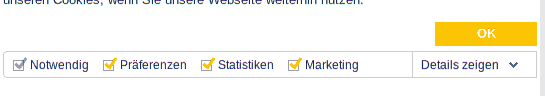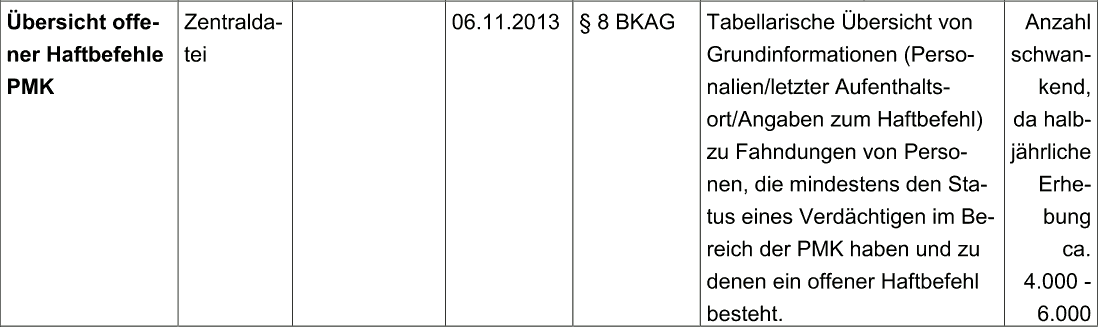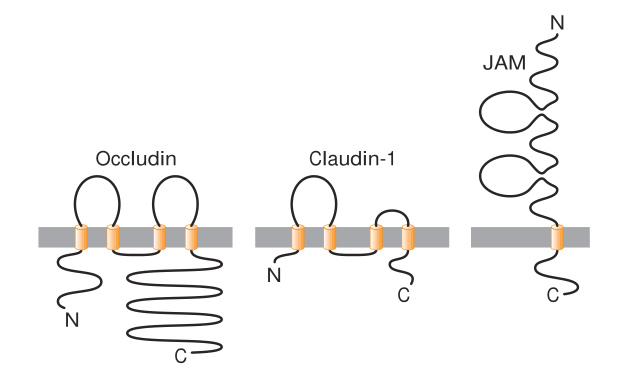Impfpass ohne App, Apple und Google
Morgen werden zwei Wochen seit meiner zweiten Corona-Impfung vergangen sein. Damit wird die Impfpassfrage für mich relevant: Mit so einem Ding könnte ich wieder in die Mensa gehen!
Allerdings habe ich, soweit ich das sehe, keinen Zugang zur offiziellen Covpass-App, weil ich mich von Apples Appstore und Googles Playstore fernhalte und eigentlich auch die Toolchains der beiden nicht auf meinem Rechner haben will. Immerhin gibt es (es lebe der Datenschutz-Aktivismus, der für offene Entwicklung von dem Kram gesorgt hat) die Quellen der Apps (wenn auch leider auf github). Wie kompliziert kann es schon sein, das ohne den ganzen proprietären Zauber nachzubauen?
Stellt sich raus: schon etwas, aber es ist ein wenig wie eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft: Die Story entwickelt sich wie beim Schälen einer Zwiebel. Schale um Schale zeigt sich, dass die Wahrheit immer noch tiefer liegt.
Bei Lovecraft sind nach dem Abpulen der letzten Schale meist alle ProtagonistInnen tot oder wahnsinnig. Im Fall der Covpass-App hingegen ist der Kram sogar dokumentiert: So finden sich die halbwegs lesbare Dokumentation des Datenstroms im QR-Code und das JSON-Schema – leider schon wieder auf github.
Schale 1: QR-Code scannen
Ich dachte mir, zum Nachbauen der Covpass-App sollte ich erstmal ihre Eingabe verstehen, also die Daten aus den beiden Impfzertifikaten lesbar darstellen. Der erste Schritt dazu ist etwas, das QR-Codes lesen kann. Ich hatte anderweitig schon mit zbar gespielt, für das es das Debian-Paket python3-zbar gibt. Damit (und mit der unverwüstlichen Python Imaging Library aus python3-pillow) geht das so, wenn das Foto mit dem Zertifikat in der Datei foto.jpeg liegt:
def get_single_qr_payload(img):
img = img.convert("L")
scanner = zbar.ImageScanner()
scanner.parse_config('enable')
image = zbar.Image(img.size[0], img.size[1], 'Y800', data=img.tobytes())
if not scanner.scan(image):
raise ValueError("No QR code found")
decoded = list(image)
if len(decoded)>1:
raise ValueError("Multiple QR codes found")
return decoded[0].data
encoded_cert = get_single_qr_payload(Image.open("foto.jpeg"))
Im Groben wandele ich in der Funktion das Bild (das wahrscheinlich in Farbe sein wird) in Graustufen, denn nur damit kommt zbar zurecht. Dann baue ich eine Scanner-Instanz, also das Ding, das nachher in Bildern nach QR-Codes sucht. Die API hier ist nicht besonders pythonesk, und ich habe längst vergessen, was parse_config('enable') eigentlich tut – egal, das ist gut abgehangene Software mit einem C-Kern, da motze ich nicht, noch nicht mal über diesen fourcc-Unsinn, mit dem vor allem im Umfeld von MPEG allerlei Medienformate bezeichnet werden; bei der Konstruktion des zbar.Image heißt „8 bit-Graustufen“ drum "Y800". Na ja.
Der Rest der Funktion ist dann nur etwas Robustheit und wirft ValueErrors, wenn im Foto nicht genau ein QR-Code gefunden wurde. Auch hier ist die zbar-API vielleicht nicht ganz preiswürdig schön, aber nach dem Scan kann mensch über zbar.Image iterieren, was die verschiedenen gefundenen Barcodes zurückgibt, zusammen mit (aus meiner Sicht eher knappen) Metadaten. Das .data-Attribut ist der gelesene Kram, hier als richtiger String (im Gegensatz zu bytes, was ich hier nach der python3-Migration eher erwartet hätte).
Schale 2: base45-Kodierung
Das Ergebnis sieht nach üblichem in ASCII übersetzten Binärkram aus. Bei mir fängt der etwa (ich habe etwas manipuliert, das dürfte so also nicht dekodieren) so an: HC1:6B-ORN*TS0BI$ZDFRH%. Insgesamt sind das fast 600 Zeichen.
Als ich im Wikipedia-Artikel zum Digitalen Impfnachweis gelesen habe, das seien base45-kodierte Daten, habe ich erst an einen Tippfehler gedacht und es mit base85 versucht, das es in Pythons base64-Modul gibt. Aber nein, weit gefehlt, das wird nichts. War eigentlich klar: die Wahrscheinlichkeit, dass was halbwegs Zufälliges base85-kodiert keine Kleinbuchstaben enthält, ist echt überschaubar. Und base45 gibts wirklich, seit erstem Juli in einem neuen RFC-Entwurf, der sich explizit auf QR-Codes bezieht. Hintergrund ist, dass der QR-Standard eine Kodierungsform (0010, alphanumeric mode) vorsieht, die immer zwei Zeichen in 11 bit packt und dafür nur (lateinische) Großbuchstaben, Ziffern und ein paar Sonderzeichen kann. Extra dafür ist base45 erfunden worden. Fragt mich bloß nicht, warum die Leute nicht einfach binäre QR-Codes verwenden.
Es gibt bereits ein Python-Modul für base45, aber das ist noch nicht in Debian bullseye, und so habe ich mir den Spaß gemacht, selbst einen Dekodierer zu schreiben. Technisch baue ich das als aufrufbares (also mit einer __call__-Methode) Objekt, weil ich die nötigen Tabellen aus dem globalen Namensraum des Skripts draußenhalten wollte. Das ist natürlich ein Problem, das verschwindet, wenn sowas korrekt in ein eigenes Modul geht.
Aber so gehts eben auch:
class _B45Decoder:
chars = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ $%*+-./:"
code_for_char = dict((c, i) for i, c in enumerate(chars))
sig_map = [1, 45, 45*45]
def __call__(self, str):
raw_bytes = [self.code_for_char[s] for s in str]
cooked_bytes = []
for offset in range(0, len(raw_bytes), 3):
next_raw = raw_bytes[offset:offset+3]
next_bytes = sum(w*v for w,v in
zip(self.sig_map, next_raw))
if len(next_raw)>2:
cooked_bytes.append(next_bytes//256)
cooked_bytes.append(next_bytes%256)
return bytes(cooked_bytes)
b45decode = _B45Decoder()
Die b45decode-Funktion ist, wenn mensch so will, ein Singleton-Objekt der _B45Decoder-Klasse (so hätten das jedenfalls die IBMlerInnen der CovPass-App beschrieben, vgl. unten). Ansonsten bildet das den Grundgedanken von base45 ziemlich direkt ab: Immer drei Bytes werden zur Basis 45 interpretiert, wobei die Wertigkeit der verschiedenen Zeichen im Dictionary code_for_char liegt. Die resultierende Zahl lässt sich in zwei dekodierte Bytes aufteilen. Nur am Ende vom Bytestrom muss mensch aufpassen: Wenn die dekodierte Länge ungerade ist, stehen kodiert nur zwei Byte.
Und ja: vielleicht wärs hübscher mit dem grouper-Rezept aus der itertools-Doku, aber die next_raw-Zuweisung schien mir klar genug.
Schale 3: zlib
Ein b45decode(encoded_cert) gibt erwartungsgemäß wilden Binärkram aus, etwas wie b'x\x9c\xbb\xd4\xe2\xbc\x90Qm!… Das sind, ganz wie die Wikipedia versprochen hat, zlib-komprimierte Daten. Ein zlib.decompress wirkt und führt auf etwas, in dem zum ersten Mal irgendetwas zu erkennen ist; neben viel Binärkram findet sich etwa:
...2bdtj2021-07-01bistRobert Koch-InstitutbmamOR...
Keine Frage: Ich mache Fortschritte.
Schale 4: CBOR/COSE
An dieser Stelle bin ich auf mir unbekanntes Terrain vorgestoßen: CBOR, die Concise Binary Object Representation (Nerd-Humor: erfunden hat das Carsten Bormann, weshalb ich auch sicher bin, dass das Akronym vor der ausgeschriebenen Form kam) alias RFC 7049. Gedacht ist das als so eine Art binäres JSON; wo es auf die Größe so ankommt wie bei QR-Codes, habe ich schon Verständnis für diese Sorte Sparsamkeit. Dennoch: Sind Protocol Buffers eigentlich tot?
Praktischerweise gibt es in bullseye das Paket python3-cbor2. Munter habe ich cbor2.loads(raw_payload) geschrieben und war doch etwas enttäuscht, als ich etwas wie:
CBORTag(18, [b'\xa1\x01&',
{4: b'^EVf\xa5\x1exW'},
b'\xa4\x01bDE...',
b'\xf9\xe9\x9f...'])
zurückbekommen habe. Das ist deutlich mehr viel Binärrauschen als ich erhofft hatte. Aber richtig, das Zeug sollte ja signiert sein, damit die Leute sich ihre Impf- und Testzertifikate nicht einfach selbst schreiben. Die hier genutzte Norm heißt COSE (nämlich CBOR Object Signing and Encryption, RFC 8152 aus dem Jahr 2017). Ich habe das nicht wirklich gelesen, aber Abschnitt 2 verrät gleich mal, dass, wer an einer Signaturprüfung nicht interessiert ist (und das bin ich nicht, solange ich nicht vermuten muss, dass meine Apotheke mich betrogen hat), einfach nur aufs dritte Arrayelement schauen muss. Befriedigenderweise ist das auch das längste Element.
Ein wenig neugierig war ich aber schon, was da noch so drinsteht. Die 18 aus dem CBORTag heißt nach Abschnitt 4.2, dass das eine Nachricht mit nur einer Unterschrift ist, und der letzte Binärkram ist eben diese eine Unterschrift. Das erste Array-Element sind Header, die mit unterschrieben werden, wieder CBOR-kodiert. Dekodiert ist das {1: -7}, und Überfliegen der COSE-Spezifikation (Tabellen 2 und 5) schlägt vor, dass das heißt: der Kram ist per ECDSA mit einem SHA-256-Hash unterschrieben.
Tabelle 2 von COSE erklärt auch das nächste Element, die Header, die nicht unterschrieben werden (und über die mensch also Kram in die Nachrichten einfummeln könnte). Das sieht auch erstmal binär aus, ist aber ein „entpacktes“ Dictionary: In meiner Nachricht steht da nur ein Header 4, was der „Key Identifier“ ist. Der Binärkram ist schlicht eine 64-bit-Zahl, die angibt, mit welchem Schlüssel die Unterschrift gemacht wurde (bei PGP wären das die letzten 8 byte des Fingerabdrucks, viel anders wird das bei COSE auch nicht sein).
Schale 5: CBOR lesbar machen
Zurück zu den Zwiebelschalen. Wenn also die Nutzdaten im dritten Element des Array von oben sind, sage ich:
cbor_payload = cbor2.loads(cose_payload.value[2])
Heraus kommt dabei etwas wie:
{1: 'DE', 4: 1657705736, 6: 1626169736,
-260: {1: {'v': [{'co': 'DE', 'dn': 2, 'dt': '2021-07-01',
'is': 'Robert Koch-Institut', 'ma': 'ORG-100030215',
'mp': 'EU/1/20/1528', 'sd': 2, 'tg': '840539006',...}]}}}
– das ist ziemlich offensichtlich die Datenstruktur, die der Zauber liefern sollte. Nur sind die Schlüssel wirklich unklar. v könnte wohl „Vaccination“ sein, is der Issuer, also der Herausgeber des Impfpasses; die Werte von 4 und 6 sehen verdächtig nach Unix-Timestamps in der nächsten Zeit aus (ja, es sind schon sowas wie 1,6 Milliarden Sekunden vergangen seit dem 1.1.1970).
Aber Raten ist doof, wenn es Doku gibt. Wie komme ich also zu …
![[RSS]](./theme/image/rss.png)